|

Internationale Zeitschrift für Personzentrierte
und Experienzielle Psychotherapie und Beratung
facultas
Universitätsverlag
ÄGG
| APG-Forum | DPGG | GwG | IPS der APG | ÖGwG | pca-acp | VRP
(neue & aktuelle Website in
Vorbereitung)
Redaktion: Christiane Bahr, Michael Behr, Franz Berger, Ulrike Diethardt, Jobst
Finke, Mark Galliker, Diether Höger, Dagmar Hölldampf, Robert Hutterer, Wolfgang
W. Keil, Christian Korunka, Gerhard Lukits, Peter F. Schmid, Hermann Spielhofer,
Tobias Steiger, Gerhard Stumm, Monika Tuczai
|
© Peter F. Schmid pfs
1998-2006
 Letzte hier enthaltene
Ausgabe
2 | 2005
Letzte hier enthaltene
Ausgabe
2 | 2005
 Nächste Ausgaben
darnach
& Vorschau
2 | 2005 - 2 | 2006
Nächste Ausgaben
darnach
& Vorschau
2 | 2005 - 2 | 2006
 Vorhergehende
Ausgaben 1 | 1997ff
Vorhergehende
Ausgaben 1 | 1997ff
1|97
2|97
1|98
1|99
2|99
1|00
2|00
1|01
2|01 1|02 2|02 1|03
2|03 1|04 2|04
 Register: Inhalt aller Hefte 1 | 1997 - 1 | 2005
Register: Inhalt aller Hefte 1 | 1997 - 1 | 2005
 Herausgeberinnen,
Verleger, Redaktion
Herausgeberinnen,
Verleger, Redaktion
 Grundsätzliches
zur Blattlinie
Grundsätzliches
zur Blattlinie
 Hinweise zur Manuskriptabgabe
Hinweise zur Manuskriptabgabe
 Bestellung
Bestellung
Die
Herausgeber und Herausgeberinnen sind dem von Carl
Rogers und seinen Mitarbeitern begründeten
Personzentrierten Ansatz verpflichtet. Dieser
Ansatz wurde im deutschen Sprachraum im Rahmen der
Psychotherapie unter den Bezeichnungen „Gesprächspsychotherapie“,
„Klientenzentrierte Psychotherapie“ und
„Personzentrierte Psychotherapie“ bekannt.
Seit Beginn hat der Ansatz unterschiedliche
Differenzierungen und Weiterentwicklungen
erfahren.
Die
Begriffe „personzentriert“ und „experenziell“
und die mit ihnen verbundenen Konzepte und
Prozesse beruhen auf einer umfassenden und
reichhaltigen Geschichte und sind ständig in
Entwicklung begriffen. Die Bezeichnung
„personzentriert und experienziell“ wurde gewählt,
um fortgesetzten Dialog und beständige
Entwicklung zu fördern; es ist nicht
beabsichtigt, ein bestimmtes Verständnis dieser
Ansätze und ihrer Beziehung zueinander zu
bevorzugen.
Die
Zeitschrift dient als Forum der Diskussion dieser
Entwicklungen und ihrer Umsetzung innerhalb und außerhalb
der Psychotherapie in den Bereichen
der Human- und Sozialwissenschaften, der
Ausbildung, Kultur und Wirtschaft. Dies gilt
sowohl für die wissenschaftliche Forschung und
Theoriebildung als auch für Lehre und Praxis. Die
Zeitschrift bietet außerdem einen Rahmen für
Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit anderen
kulturellen, wissenschaftlichen, philosophischen
und künstlerischen Strömungen.

 Heft
1 | 1997
Heft
1 | 1997
•
Klienten–/Personzentrierte
Psychotherapie am Wiener Weltkongreß 1996
Editorial
Christian Korunka
Wolfgang W.
Keil
Hermeneutische Empathie
in der Klientenzentrierten Psychotherapie
5–13
Es wird die These vertreten,
dass die Empathie in der Klientenzentrierten
Psychotherapie eine hermeneutische Funktion
erfüllen muss. Dementsprechend beinhaltet das
empathische Verstehen des Therapeuten mehr als das
anfängliche Selbstverstehen des Klienten.
Hermeneutik wird hier im Sinn von Gadamer
verstanden. Hermeneutische Empathie versucht
demnach, in der Begegnung mit unvollständigem
Klienten-Erleben dessen Ganzheit und Stimmigkeit
aufzufinden. Im Empathieverständnis von Rogers und
im Konzept der Wiederherstellung von Gendlin
deutet sich diese hermeneutische Dimension an. Im
Sinn der Theorie der zwischenmenschlichen
Beziehungen von Rogers bieten vor allem die
kongruenten nicht-akzeptierenden und
nicht-verstehenden Reaktionen des Thearapeuten den
hermeneutischen Schlüssel zum Verstehen der
Inkongruenz des Klienten. Ein Paradigma für die
Entwicklung dieses Verstehens bietet Lorenzers
Konzept des szenischen Verstehens bzw. m.E. die
interaktionelle Orientierung von van Kessel & van
der Linden.
Die konkrete Umsetzung der hermeneutischen
Empathie in der Klientenzentrierten Therapie wird
im Form von sich vertiefenden Schritten
beschrieben. Zunächst muss der Therapeut seine
wirklichen Reaktionen auf den Klienten genau
wahrnehmen. Die nicht-verstehenden und
nicht-akzeptierenden Reaktionen verweisen dabei am
meisten auf die Inkongruenzen des Klienten. Unter
Einbezug einer lebensgeschichtlichen Perspektive
kann im weiteren die Entstehung, Not-wendigkeit
und identitätsstützende Weiterentwicklung der
Inkongruenz im Leben des Klienten intuitiv
erschlossen werden. Im Fall von Inkongruenzen, die
klassische psychische Störungen mit sich bringen,
wird hermeneutisches Verstehen erst ermöglicht
durch einfühlendes Wissen vom Wesen und der
Entstehung solcher Störungen. Abschließend wird
noch auf inkongruente Therapeutenreaktionen
eingegangen. Diese verweisen nicht auf den
Klienten, sondern sollten den Therapeuten zu einem
adäquateren Selbstverstehen anregen. Erst dann ist
er in der Lage, kongruent auf den Klienten zu
reagieren. Die Hervorhebung der kongruenten
nicht-akzeptierenden und nicht-verstehenden
Therapeutenreaktionen soll hingegen deutlich
machen, dass klientenzentrierte Empathie
oberflächlich und unwirksam bliebe, wenn nicht
auch ihre hermeneutische Dimension gesehen und
umgesetzt wird.
Peter F. Schmid
"Einem Menschen begegnen heißt. von einem Rätsel
wachgehalten werden." (E. Lévinas)
Perspektiven zur Weiterentwicklung des Personzentrierten Ansatzes
14–24
10 jahre nach dem Tod von
Carl Rogers lässt sich ein Resümee ziehen: Was
haben uns bald sechs Jahrzehnte des
Personzentrierten Ansatzes gebracht? Welche
Folgerungen ergeben sich daraus –
wissenschaftlich, gesellschaftlich, praktisch? Und
wie sehen die Perspektiven für die Zukunft des
Personzentrierten Ansatzes aus? In welche Richtung
steht eine Weiterentwicklung an?
Es wird die These vetreten, dass dies auf einen
wahrhaft personalen und sozialen Ansatz hin
geschehen soll, der dann auch zu einem
Grundkonsens jener Schulen beitragen kann, die
sich einem dialogischen und begegnungsorientierten
Verständnis von Psychotherapie verpflichtet wissen
und den entsprechenden Paradigmenwechsel in
Theorie und Praxis vollziehen. Insofern tritt der
Ansatz an, - wie jeder gute Therapeut in einer
Therapie – sich selbst überflüssig zu machen.
Nicht etwa, weil eine solche „Therapie der
Zukunft“ (Carl Rogers) bereits Realität wäre; im
Gegenteil, die konsequente Verwirklichung des
Rogerianischen Paradigmenwechsels steht auch für
den Personzentrierten Ansatz selbst erst noch aus.
Christine Butterfield–Meisel,
Boglarka Hadinger, Wolfgang W. Keil, Wolfram Kurz, Felix de Mendelssohn, Peter
F. Schmid, Marianne Schwager–Scheinost
Dialog der Schulen: Ähnlichkeiten und Differenzen
Podiumsdiskussion im Rahmen des Weltkongresses für Psychotherapie 1996 25–39
Bei diesem Gespräch, das
wegen des enormen Pulikumsinteresse in einem
überfüllten Saal stattfand, kamen einzelne
zentrale Bereiche der Psychotherapie und ihr
Verständnis in der psychoanalytischen
Psychotherapie, der Logotherapie und der
Klienten-/Personzentrierten Therapie zur Sprache –
darunter besonders die unter den Keywords
genannten Themen. Selbstverständlich mussten in
einem solchen Rahmen sowohl die Themen wie deren
Behandlung fragmentarisch bleiben. Wie bei solchen
Gesprächen öfter, erwies es sich als schwierig,
über den eigenen Jargon hinaus echte Verständigung
über Inhalte zu erzielen. Nicht zuletzt war es dem
Publikum zu danken, dass einzelne Themen
systematischer behandelt wurden. Bei allen
Differenzen, etwa hinsichtlich des Stellenwerts
des Unbewussten, stellten sich eine Reihe von
Ähnlichkeiten bzw. Gemeinsamkeiten heraus,
besonders hinsichtlich der Bedeutung der
Beziehung. Freilich zeigten sich gerade auch da
noch gravierende Unterschiede, etwa im
Selbstverständnis des Therapeuten bzw. der
Therapeutin.
Jochen Eckert
Welcher Klient mit welcher Störung profitiert von einer
Gesprächspsychotherapie?
Entwicklung und Stand der Indikationsfrage in der Klientenzentrierten
Psychotherapie 40–47
Einleitend wird
herausgestellt, dass die kritische Haltung, die
Carl Rogers gegenüber Diagnosen und Diagnostik
eingenommen hat, nicht mit einer generellen
Ablehnung gleichzusetzen ist. Es wird dann
versucht, Antworten auf folgende Fragen zu geben:
Welche diagnostischen Kriterien sprechen für eine
positive Indikationsstellung, unter welchen
Bedingungen ist eine Gesprächspsychotherapie nicht
und unter welchen kontraindiziert?
Eva–Maria Biermann–Ratjen
Eine klientenzentrierte Krankheitslehre 48–55
Der zentrale Begriff der
Klientenzentrierten Krankheitslehre ist die
Inkongruenz zwischen der gesamtorganismischen
Bewertung von Erfahrung und ihre Bewertung als das
Selbstkonzept bestätigend oder bedrohend. Diese
Bewertungen und ihre Nichtübereinstimmung können
als affektive und damit Selbsterfahrungen bewusst
werden, aber auch dem Bewusstsein mehr oder
weniger vollständig ferngehalten, d.h. abgewehrt
werden. Im Klientenzentrieten Konzept wird
zwischen mehr oder weniger früh gestörten
Selbstkonzepten unterschieden, d.h. zwischen mehr
oder weniger fully functioning persons mit
entsprechend geringerer oder größerer
Vulnerabilität bzw. primärer Inkongruenz.
Psychopathologische Phänomene werden im
Klientenzentrierten Konzept als Ausdruck akuter
oder chronischer sekundärer Inkongruenz
verstanden: Sowohl die das Selbstkonzept
bedrohenden Erfahrungen als auch die Erfahrungen
des Bedrohtseins im eigenen Selbstverständnis
sowie deren affektive Bewertung und/oder Abwehr
können akut oder chronisch und ganz oder teilweise
im Bewusstsein symbolisiert sein.
T. Len Holdstock
Paradoxes and challenges facing the person-centered
approach 56–61
As we approach the 21st
Century, major challenges await the
Person-Centered (PC) Approach if it is to continue
in the pioneering spirit of Carl Rogers and remain
true to being oriented. One challenge relates to
the resolution of the internal contradictions
within the approach. Another relates to the
ethnocentrism of the approach. Both challenges
center on the concept of the self that underlies
the PC Approach. In terms of recent work in
mainstream psychology and several other
disciplines on the concept of the self, different
models of the self seem to be entertained in PC
Therapy for the client and the therapist. The
concept appropriate for optimal functioning of the
client can be described as high on agency and
independence (the separate self) and that for the
therapist as high on agency and relatedness (the
autonomous-relational self). Resolution of this
discrepancy can not only resolve the internal
contradictions within the approach, but align the
purpose of PC Therapy with recent models of the
concept of the self underlying mental health, as
well as facilitate the approach to transcend its
individuocentric cultural boundaries.
Gerd–Walter Speierer
Personzentrierte Krisenintervention 62–65
Ein Konzept zum Verständnis
von Krisen, zur Berücksichtigung unterschiedlicher
Krisenursachen und zur Planung bzw. Durchführung
patienten- bzw. klientenbezogener, ätiologisch-,
zustands- und zielorientierter Hilfen für Personen
in Krisen wird dargestellt. Seine theoretische
Grundlage ist das vom Autor entwickelte
Differentielle Inkongruenzmodell (DIM) der
Gesprächpsychotherapie (Speierer 1994).
Marlis Pörtner
Wider die Beliebigkeit — spezifische Aspekte der Klientenzentrierten
Psychotherapie 66–71
Die Klientenzentrierte
Psychotherapie sieht sich oft dem Vorwurf der
Verschwommenheit und Beliebigkeit ausgesetzt. Es
erscheint deshalb sinnvoll, genauer darüber
nachzudenken und zu verdeutlichen, was die
Eigenart dieser Therapieform ausmacht. Neben der
Grundhaltung des Therapeuten – Empathie,
Wertschätzung und Kongruenz – gibt es einige
weitere Aspekte, die spezifisch sind für die
Klientenzentrierte Psychotherapie und die sowohl
theoretische wie praktische Bedeutung haben:
- Relativität der Werte
- Der Weg ist ebenso wichtig wie das Ziel
- Nicht der Inhalt steht im Mittelpunkt,
sondern der Prozess
- Nicht die Defizite sind entscheidend,
sondern die Ressourcen
- Die kleinen Schritte
- Das Wichtigste geschieht außerhalb der
Therapiestunde
Das Berücksichtigen dieser Aspekte trägt dazu bei,
Klientenzentrierte Psychotherapie nicht als
diffuses Heilsversprechen misszuverstehen, sondern
sie als das wahrzunehmen, was sie ist: ein
Instrument, das Menschen ermöglicht, sich mit sich
selbst, mit ihren Schwierigkeiten und mit ihrer
Umwelt auseinanderzusetzen, bisher nicht bewusste
Seiten ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen,
schlummernde Ressourcen und neue
Handlungsspielräume zu entdecken, ihren eigenen
Weg zu finden und Verantwortung für sich zu
übernehmen.
Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen lassen
sich keine Techniken ableiten, dennoch ergeben
sich Konsequenzen für die Praxis. Das Wahrnehmen,
Aufgreifen und Respektieren der beschriebenen
Aspekte ist ein wesentlicher Bestandteil der
therapeutischen Arbeit. Wie sich das konkret
auswirkt, wird anhand von Beispielen erläutert.
Maria Bruckbäck
Die Verbalisation des Selbst 72–74
Die Verbalisation des Selbst bedeutet den
ernsthaften Versuch, sein gewordenes und werdendes
Selbst subjektiv und prozessorientiert zu
verbalisieren.
Die Möglichkeit eines Menschen, sein Selbst
adäquat verbal zu äußern, setzt seine Bereitschaft
sich zu öffnen voraus, um dieses Selbst zu
erforschen. Soll bewusst vom Eigenen die Rede
sein, ist die Anerkennung der inneren Bedürfnisse
die notwendige Voraussetzung, um sie zur Sprache
zu bringen, sie auszudrücken und sie als
Beziehungsmittelpunkt inmitten des Verwoben- und
Involviertseins mit der Umwelt wahrzunehmen.
Dazu wird exemplarisch der Ansatz von Lacan, der
ein tiefes, nicht fassbares Verständnis der
Struktur der Selbstverbalisation bietet und der
Ansatz von Tamm, der einen Zugang zur
Selbstverbalisation über die Reflexion der
eingenen Ansprüche und Leitideen gibt,
beschrieben.
Dieser Artikel bietet einen Beitrag zur
Aussagefähigkeit des durch Krisen und Leid auf
sich selbst verwiesenen und sich selbst
reflektierenden Individuums im therapeutischen
Prozess.
Bernie Neville
The Person-Centred Ecopsychologist 75–81
Eco-psychology challenges
the anthropocentric and egocentric assumptions in
which most therapies are grounded. It is argued
that, while client-centred therapy conventionally
focusses on the internal congruence of the
individual, the congruence between person and
planet also comes within its scope. Client-centred
therapy is able to deal not only with personal
anxiety but with species anxiety, which is
manifested in both personal and collective
pathology. The primacy of the individual and the
primacy of the planet must both be fully
acknowledged if healing is to take place.
Ned L. Gaylin
Client–Centered Family Therapy
Individual and ecosystemic issues 82–85
Conducted within the context
of the family therapy incorporates but also
transcends dimensions of classic individual
client-centered psychotherapy. When
client-centered therapy is conducted within the
family context its impact and efficaciousness is
profoundly enhanced. Rogers’ “necessary and
sufficient conditions” for psychotherapeutic
change are directly transferable to the context of
client-centered family therapy but require
conceptual augmentation which create subtle but
portentous new dimensions in the milieu of family
therapy.
Leon Niebrzydowski
Self–disclosure empathy and sexual dissatisfactions as
the factors conditioning a successful marriage 86–89
Aktuelle Literatur
zum Personzentrierten Ansatz
zusammengestellt von Peter F. Schmid
U3

 Heft
2 | 1997
Heft
2 | 1997
Editorial
Lore Korbei 95
Peter F. Schmid
Die
"Arbeitsgemeinschaft Personenzentrierte Psychotherapie, Gesprächsführung
und Supervision (APG) – Vereinigung für Beratung Therapie und
Gruppenarbeit"
Geschichte, Entwicklungen, Zielsetzungen 97–110
Dieser Beitrag skizziert die
geschichtliche Entwicklung und das gewachsene
Selbstverständnis der APG, die in Wien,
hervorgegangen aus dem „team für angewandte
sozialpsychologie (tas)“, in direkter
Zusammenarbeit mit Carl Rogers und seinen
Mitarbeitern in La Jolla entstanden ist. Das
gegenwärtige Selbstverständnis, die
wissenschaftliche und praktische Arbeit und die
Ausbildungstätigkeiten werden dokumentiert.
Wolfgang W. Keil
Geschichtliche Entwicklung und inhaltliche Ausrichtung der
ÖGwG (Österreichische Gesellschaft für wissenschaftliche, klientenzentrierte
Pschotherapie und personorientierte Gesprächsführung)
111-116
Peter Frenzel
Fortschritte in der eigenen Identitätsentwicklung
Bericht über die Vierte Internationale Konferenz für Klientenzentrierte und
Experientielle Psychotherapie, Lissabon, Juli 1997 116–119
Der Artikel versucht als
Bericht über die 1997 in Lissabon abgelaufene
Vierte Internationale Konferenz für
Klientenzentrierte und Experientielle
Psychotherapie (ICCCEP) auch einen Überblick über
die aktuellen Trends innerhalb des
Personzentrierten Ansatzes. Es werden, vor dem
Hintergrund der Kongresserfahrungen, dabei kurz
folgende Aspekte reflektiert: Welche
forschungsleitenden Fragestellungen, die die
paradigmatischen Arbeiten von Carl Rogers
aufgeworfen haben, werden international in welcher
Weise und mit welchen Ergebnissen bearbeitet?
Welche berufspolitischen Aspekte ergeben sich im
internationalen Kontext? Wohin werden die größten
Herausforderungen für personzentrierte
Praktikerinnen und Forscher erkannt?
Elisabeth Zinschitz
Der Personzentrierte Ansatz in der Behindertenarbeit
120–127
Vor neun Jahren wurde ich zu ersten Mal mit dem
Thema Behinderung konfrontiert. Damals hatte ich
keine Ahnung, was da auf mich zukam, und der
Personzentrierte Ansatz war mir noch gänzlich
unbekannt.
Als ich begann, in der Frühförderung und
Familienbegleitung mit Kleinkindern mit
verschiedenen Behinderungen zu arbeiten, dachte
ich, ich müsste mit ihnen viel üben, damit sie
ihre Behinderung möglichst viel kompensieren
könnten. Sie sollten von mir lernen zu greifen, zu
schauen, zu hören, zu sprechen. Inzwischen habe
ich von ihnen gelernt zu begreifen, genau zu
schauen, genau hinzuhören und ihre Sprache zu
sprechen. Während der selben Zeit lernte ich den
Personzentrierten Ansatz kennen, der mir in diesem
Prozess äußerst hilfreich war.
Ein sehr wichtiger Schwerpunkt in meiner Arbeit
ist die Lebensqualität, wobei Integration und
Autonomie eine wichtige Rolle spielen. Um einem
behinderten Menschen dabei zu helfen, das zu
erreichen, ob in der Psychotherapie oder in einem
anderen Rahmen, ist es m.E. erforderlich,
einerseits zu verstehen, wie seine Behinderung,
seine seelische Entwicklung beeinflusst hat, und
anderseits, diesem Menschen als ganzer Person zu
begegnen und nicht den Fokus auf die Behinderung
zu legen. Nur so kann ich seinen inneren
Bezugsrahmen verstehen und ihm helfen, das eigene
Erleben ernst zu nehmen, die eigenen Grenzen
wahrzunehmen und im jeweils möglichen Rahmen
selbst bestimmend zu leben.
Wolfgang W. Keil
Zum gegenwärtigen Stand der Klientenzentrierten
Psychotherapie 128–137
Nach einer Klärung des
Unterschieds von Klientenzentrierter Therapie und
Personzentriertem Ansatz wird ein Überblick über
den gegenwärtigen Stand der Klientenzentrierten
Therapie versucht. Dabei werden entsprechend ihren
verschieden akzentuierten Zielen drei Richtungen
der Klientenzentrierten Therapie differenziert.
Als Ziele werden die Verwirklichung der
Grundhaltungen, das Gewahrwerden der
störungsspezifischen Inkongruenz und die (Wieder-)Hrstellung
des Experiencing-Prozesses angesehen. Abschließend
wird auf die Gruppe als ursprünglichen Ort der
Personzentrierten Therapie hingewiesen. Die
Entwicklung der Klientenzentrierten
Gruppentherapie und der klientenzentrierten
Kinder- und Familientherapie werden als Beleg für
die dem Personzentrierten Ansatz inhärente
Pilosophie der relationalen Bezogenheit des
Individuums dargestellt.
Ilse Schneider
Begegnung mit Natalie Rogers
Personzentrierte Ausdruckstherapie (12.-14. Sept. 97), Weggis, Schweiz
138–143
„Begegnung mit Nathalie
Rogers“ ist der Versuch einer subjektiven und
objektiven Beschreibung der Eindrücke der Autorin
von einem Workshop im Weggis am Vierwaldstättersee/Schweiz,
12.-14.9.1997 mit Natalie Rogers, der Gründerin
der „Person-Centered Expressive Therapy“ (PCET).
Peter F. Schmid
Förderung von Kompetenz durch Förderung von Kongruenz
Inhaltliche und berufspolitische Aspekte Personzentrierter Supervision
144–154
Supervision als Spezialfall einer
personzentrierten Beziehung zeichnet sich durch
un-mittel-bare Begegnung von Person zu Person und
durch das Vertrauen des Supervisors in das
Potential seines Partners beziehungsweise in die
Ressourcen des Systems aus und ist solcherart der
Prototyp von „facilitative supervision“.
Personzentrierte Supervision als Förderung
beruflicher Entwicklung durch
Persönlichkeitsentwicklung ist die Reflexion des
beruflichen Praxis mit Hilfe einer solchen
Beziehung, wobei die aktuellen
Beziehungserfahrungen in der Supervisionssituation
der Schlüssel zum Verständnis sind. Der Ansatz
liegt bei Wahrnehmung und Bearbeitung von
Inkongruenz, sei es der Person, sei es der
Organisation. Dabei kommt dem Verständnis und dier
kongruenten Gestaltung der Rolle und der Gruppe
als Schnittstelle zwischen Person und Gesellschaft
eine besondere Bedeutung zu.
Die personzentrierte Theorie der Supervision läuft
manchen gegenwärtigen Tendenzen der
begrüßenswerten Professionalisierung durch
Ausgestaltung einer eigenständigen Berufsrolle des
Supervisors quer, insbesondere was das Phantasma
eines „ansatzübergreifenden“
Supervisionsverständnisses und die bisweilen
supervisoren-, ja verbandszentrierte Diskussion um
Supervision betrifft.
Lore Korbei
"Was Peter über Paul sagt ..."
Supervision aus der Sicht einer Pschotherapeutin 155–159
Supervision bezieht sich auf
ein Interaktionsfeld, das der Supervisand/die
Supervisandin berichtend anbietet. Gleichzeitig
aber ist die Kommunikation zwischen Supervisandin
und Supervisorin eine wichtige Informationsquelle.
Supervision im Rahmen der Ausbildung zur/zum
Psychotherapeuten/in beinhaltet auch
Kontrollfunktion und Wissensvermittlung neben den
Angeboten zur Selbsterfahrung.
IPS der APG und ÖGwG
Person–/Klientenzentrierte Supervision und
Organisationsentwicklung
Statut und Ausbildungsordnung von ÖGwG und IPS der APG 160–167
Peter F. Schmid
"to further cooperation on an international level in
the field of psychotherapy and counseling ..."
Zur Gründung der World Association for Person-Centered Counseling and
Psychotherapy (WAPCCP). An Association for the Science and Practice of Client–Centered
and EXperiential Pychotherapies and Counselling 168–171
PERSON dokumentiert im
folgenden das Statut mitsamt der
Ausbildungsordnung der neuen gemeinsamen Aus-,
Fort- und Weiterbildung
„Person-/Klientenzentrierte Supervision und
Organisationsentwicklung“ des Instituts für
Personzentrierten Studien der APG (IPS) und der
ÖGwG. Im Anhang finden sich Hinweise für die
Anrechenbarkeit für Personen, die bereits eine
Ausbildung bei APG oder ÖGwG absolviert haben oder
dort in Ausbildung sind.
World Association for
Person-Centered Counseling and Psychotherapy (WAPCCP). An Association for the
Science and Practice of Client–Centered and EXperiential Pychotherapies and
Counselling
Provisional Statutes 172f
Weitere aktuelle
Literatur zum Personzentrierten Ansatz
zusammengestellt von Peter F. Schmid
U3

 Heft
1 | 1998
Heft
1 | 1998
•
10 Jahre nach dem Tod
von Carl Rogers — Das Vermächtnis als Herausforderung
Editorial
Christian Korunka / Elisabeth Zinschitz
3-4
Maureen O'Hara
Personzentrierte
und experientielle Psychotherapie in einem kulturellen Übergangszeitalter 5–14
Der
Beitrag ist die deutsche Übersetzung eines Vortrags,
den Maureen O'Hara, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der zeitgenössischen
Humanistischen Psychologie, im Rahmen des PCA-Symposiums in Wien gehalten hatte. Ausgehend
von einer historischen Perspektive versucht sie eine Einschätzung der Zukunft der
Personzentrierten Psychotherapie in einem "kulturellen Übergangszeitalter". Aus
einem postmodernen Blickwinkel unterscheidet sie eine prämodernistische, eine moderne und
eine postmoderne Psyche. Aus dieser Sicht war die frühe Personzentrierte Psychotherapie
noch stark ein Produkt eines modernistischen Weltbildes. Die postmoderne Krise der
Gesellschaft stellt jedoch eine Chance für diese therapeutische Richtung dar, weil sie in
diesem Kontext ihre emanzipatorische Kraft und ihr Menschenbild neu entfalten kann. Der
Personzentrierte Ansatz könnte sich so zu einer Personzentrierten Psychologie der
Postmoderne entwickeln.
Peter F. Schmid
State
of the Art personzentrierten Handelns als Vermächtnis und Herausforderung
15–23
Zehn Jahre nach dem Tod von Carl Rogers
wird kairologisch Bilanz gezogen, wo der Ansatz heute steht, welche Entwicklungen seit dem
Tod des Begründers zum "Stand der Kunst" gehören und welche Aufgaben auf die
Vertreter des Ansatzes warten. Dabei werden verschiedene, für die grundlegende
Philosophie ebenso wie für die Praxis zentrale Bereiche benannt, die in den
Schlüsselwörtern aufgezählt sind. Schließlich wird auch die aktuelle österreichische
Situation und Vereinspolitik beleuchtet. [Klicken Sie, um den Beitrag auf Englisch
online zu lesen]
Schlüsselwörter: Grundlagen,
Kairologie, Anthropologie, Begegnungsphilosophie, Phänomenologie, Erkenntnistheorie,
Therapietheorie, Wissenschaftstheorie, Psychologie, Erziehung, Ausbildung, Forschung,
Politik, Ethik.
Thomas Slunecko
Diesseits
und jenseits von Begegnung
Zur Integration psychotherapeutischer Schulen aus
personzentrierter Sicht 24–31
Der Artikel
versucht zu entwickeln, wie sich
Integrationsbestrebungen innerhalb der
Psychotherapie durch den Rückgriff auf zentrale
Elemente des Personzentrierten Ansatzes,
insbesondere auf das darin formulierte Verständnis
von Begegnung, gestalten lassen; damit werden
Erkenntnis– und Wissenssansprüche formulierbar,
die der interpersonalen Natur der
psychotherapeutischen Praxis angemessener sind als
solche, die zum Zwecke einer vermeintlichen
wissenschaftlichen Aufwertung aus anderen Fächern
importiert werden. Vor allem wird auch ein
produktiver Umgang mit der Schulenvielfalt
möglich: das Bestehenlassen und im Dialog erst
wechselweise Verständlichwerden von
unterschiedlichen Positionen lässt sich als eine
konstitutive Qualität der Gesamtdisziplin
Psychotherapie verstehen, die sie sich gegenüber
vereinheitlichenden und reduktionistischen
Ansprüchen unbedingt bewahren sollte. Für den
Personzentrierten Ansatz gibt der Dialog mit den
„anderen“ Gelegenheit, sich bestimmter kultureller
und metaphysischer Erbstücke bewusst zu werden,
die in der weiteren Entwicklung problematisch
werden könnten.
Wolfgang W. Keil
Der
Stellenwert von Methoden und Techniken in der Klientenzentrierten Psychotherapie
32-44
Zur Klärung des Stellenwertes von
Methoden und Techniken in der Klientenzentrierten Therapie werden zu Beginn die
verschiedenen kontroversen Positionen dargestellt. Das Therapiekonzept von Rogers bestimmt
in radikaler Weise eine gewisse Lebensweise bzw. gewisse Grundeinstellungen als
wesentliche Faktoren der Psychotherapie. Techniken dienen höchstens dazu, diese
Grundeinstellungen zu kommunizieren. Das nähere Zusammenspiel von personaler Beziehung
und therapeutischen Methoden wird mit Hilfe des Konzepts (von Höger) von den
unterschiedlichen Abstraktionsebenen im Rogers'schen Therapiekonzept erläutert. Demnach
müssen Methode und Vorgangsweise sich von der Theorie herleiten lassen, sie werden aber
zugleich vom jeweiligen therapeutischen Kontext her bestimmt und müssen in diesem
individuell kreiert werden. Dies erfordert professionelle Kunstfertigkeit, für deren
Ausbildung die Klientenzentrierte Therapie eine ausreichende Methodik zur Verfügung
stellen soll. Eine solche Methodik wird dann in drei Formen dargestellt:
Grundorientierungen des therapeutischen Handelns in den Varianten der verschiedenen
Strömungen innerhalb der Klientenzentrierten Therapie, einzelne typische Methoden, die in
dieser Therapierichtung entwickelt worden sind, und vor allem grundlegendes
therapeutisches Handwerkszeug, das eine therapierelevante Kommunikation ermöglicht.
Peter Frenzel
Vielfalt
versus Beliebigkeit
Wie das Vermächtnis von Carl R. Rogers im Institut für
Personzentrierte Studien (IPS) als Herausforderung verstanden wird
45–56
Der Beitrag, der
als leicht verändertes Transkript bewußt in seiner
Vortragsform belassen wurde (Vortrag am 29.11.1997
im Rahmen des von der PCA veranstalteten
Symposiums anlässlich des zehnten Todesjahres von
Carl R. Rogers), beleuchtet die spezifischen
Auffassungen, wie innerhalb des Instituts für
Personzentrierte Studien (IPS) zentrale
theoretiche und praktische Positionen von Carl R.
Rogers als Herausforderung verstanden werden.
Dabei wird sowohl auf zentrale Fragen rund um das
personzentrierte Menschenbild, auf die
Herausforderung in personzentrierter Weise
Theorieentwicklung zu betreiben als auch auf
einige praktische psychotherapeutische Fragen
eingegangen, die in besonderer Weise die
spezifischen Herausforderungen verdeutlichen, die
sich ergeben, wenn man in radikaler Weise
versucht, im psychosozialen Bereich eine
Orientierung an der Person zu verwirklichen. Dabei
wird auch auf Aspekte der Ausbildung und auf (berufs)politische
Fragen eingegangen.
Sylvia Gaul
Carl
Rogers — Legitimität der Nachfolge im Spiegel person(en)/klientenzentrierter
Vereinigungen in Österreich 57–63
Vor dem Hintergrund von vier
person(en)/klientenzentrierten Vereinigungen in
Österreich, von denen drei durch Abspaltung aus
einer gemeinsamen ursprünglichen Vereinigung
entstanden sind, wird als mögliche Ursache dieser
Divergenz der Antidogmatismus des Ansatzes
beschrieben. Es wird auf die für das Wachstum
förderlichen Bedingungen eingegangen, die einen
authentischen personzentrierten wissenschaftlichen
Diskurs bedingen: Nur wenn im Vertrauen auf die
Aktualisierungstendenz auf Kontrolle verzichtet
wird, kann dieser Ansatz vor Ideologisierung und
Dogmatismus bewahrt werden.
Eva–Maria Biermann–Ratjen
Das
Phänomen Aggression betrachtet im Rahmen der Klientenzentrierten Entwicklungspsychologie
64–68
Verschiedene
Aggressionskonzepte in der Gesprächspsychotherapie
und beim Analytiker Kernberg werden diskutiert und
die Selbstverteidigungstendenz (die sich affektiv
als existentielle Angst, aber auch als
narzißtischen Wut äußern und zu sehr aggressiven
Erlebens- und Verhaltensweisen sich selbst und
anderen gegenüber führen kann) der
Selbstentwicklungstendenz (die nicht als
Aggression zu bezeichnen ist) gegenüber gestellt.
Elisabeth Jandl–Jager
Psychotherapieforschung
und Psychotherapeutische Praxis 69–74
Zunächst wird ein kurzer
Abriss der Geschichte der Psychotherapieforschung
und eine Darstellung der aktuellen Problematik der
Psychotherapieforschung in und für die Praxis
gegeben. An Hand eines Beispiels wird die
Möglichkeit einer Selbstevaluation in der Praxis
skizziert.
Aktuelle Informationen von ÖGwG und IPS 75-76
Bücher von Carl Rogers: Originale und
deutsche Ausgaben
zusammengestellt von Peter F. Schmid U3

Heft
1|1999
Editorial
Sylvia Gaul / Joachim Sauer 3f
 Schwerpunkt:
Schwerpunkt:
Der Personzentrierte Ansatz außerhalb der Psychotherapie
Walter Graf / Reinhold Pfingstner
Personzentrierte Outdoorarbeit
— Begegnung in der Natur
11-15
Der Personzentrierte Ansatz ist in der Literatur über
Outdoor-Aktivitäten und Erlebnispädagogik nur am Rande und als Ergänzung zu finden. In
diesem Beitrag soll versucht werden, wichtige Aspekte personzentrierter Outdoorarbeit
– auch in Abgrenzung zu anderen Ansätzen – herauszuarbeiten und zu zeigen, daß
es sich dabei um eine radikal andere Zugangsweise handelt.
Im weiteren werden einige wesentliche Grundsätze formuliert, welche die
Basis für eine eigenständige Theorieentwicklung personzentrierter Outdoorarbeit sein
können. Schließlich wird anhand des Beispiels "Klettern als Selbsterfahrung"
ein konkretes Konzept des Personzentrierten Ansatzes in der Outdoorarbeit vorgestellt.
Thomas Schweinschwaller und Barbara
Rainer
Theaterpädagogik als Förderung
von Probehandeln
Der Personzentrierte Ansatz in der Theaterpädagogik 16-20
Theaterpädagogik als theatrale Arbeit im
pädagogischen Kontext, als Spielen durch Improvisation, ermöglicht Selbsterfahrung im
Probehandeln. Erfahrungen aus Workshops mit Jugendlichen, verstanden als work in progress,
werden dargestellt und im Kontext personzentrierter Theorie, besonders in Hinblick auf die
Bedeutung von Beziehung und Präsenz diskutiert. Ein bedürfnisorientierter Ansatz
ermöglicht signifikantes Lernen, wenn kein "Theater vorgemacht" wird, sondern
die Haltung der Leiter davon geprägt ist, in Kontakt zu kommen.
Heimo Krebitz
Personale Begegnung in der Körperlichkeit
Ein personzentrierter Ansatz in der Medizin
21-24
Die Geschichte der Regulationsmedizin ist unter anderem gekennzeichnet durch langwierige
Auseinandersetzungen mit der Schulmedizin und das Bemühen um Anerkennung. Zahllose
Erfahrungsberichte von Medizinern waren mit dem klassisch-mechanistischen
Reiz-Reaktionsmodell der Naturwissenschaften nicht erklärbar. Sie wurden als nicht
beweisbar qualifiziert und bestenfalls der Kategorie "Placebowirkung"
zugeordnet. Die neueren Forschungsergebnisse entwickeln sich jedoch zu einer soliden Basis
für ein ausbaufähiges Theoriegebäude und tragen zu einem neuen Verständnis
organismischer Zusammenhänge bei. Parallelen zur Entwicklungsgeschichte des
Personzentrierten Ansatzes sind nicht zu übersehen; es besteht auch eine
diskussionswürdige inhaltliche Annäherung an das personzentrierte Menschenbild.
Reinhold Fartacek
Aspekte Klientenzentrierter
Psychotherapie in der Psychiatrie
am Beispiel einer stationären Krisenintervention 25-31
In der Psychiatrie begegnen einander unterschiedliche Sichtweisen von psychischen
Störungen, wie auch unterschiedliche und manchmal scheinbar gegensätzliche
therapeutische Ansätze. In der vorliegenden Arbeit werden sowohl diagnostische
Gesichtspunkte erörtert, als auch die Grundbedingungen für eine Krisenintervention in
Form der klientenzentrierten Psychotherapie. Am Beispiel der Arbeit an einer
Kriseninterventionsstation wird verdeutlicht, daß sich eine störungsspezifische und
psychodynamische Sichtweise nicht ausschließen, sondern einander in einem integrativen
Modell sinnvoll ergänzen können.
Alfred Klinglmair im Gespräch mit
Joachim Sauer
Im Spannungsfeld zwischen Person und Organisation
Möglichkeiten und Grenzen des Personzentrierten Ansatzes in der öffentlichen Verwaltung
32-37
In diesem Interview geht es um die Möglichkeiten und
Grenzen des Personzentrierten Ansatzes in der öffentlichen Verwaltung. Im Kontext eines
ganzheitlichen Verständnisses von Person und Organisation werden Fragen des
personorientierten Führungstils, der Personalführung und eines entsprechenden
Konfliktmanagements auf verschiedenen Ebenen unter besonderer Berücksichtigung der
institutionellen Rahmenbedingungen diskutiert. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht dabei
die personale Kompetenz insbesonders von Leitungspersonen.
Wolf R. Böhnisch / Andrea
Freisler-Traub / Peter Frenzel
Ein personzentrierter Ansatz in
der Hochschuldidaktik
Bericht und Reflexion zu einem selbstgesteuerten Lernexperiment im
(wirtschafts)universitären Kontext
38-46
Das Gesamtcurriculum des Forschungsschwerpunkts
Personalwirtschaft der Universität Linz beinhaltet in der letzten Ausbildungsstufe ein
Seminar mit der strategischen Vorgabe, den Studierenden weitestmögliche Freiheitsgrade
auf inhaltlicher und methodischer Ebene zu ermöglichen.
Das jüngste Lernexperiment basiert auf dem Personzentrierten Ansatz von
Carl R. Rogers und versucht sein Ideengut zum Erwachsenen-Lernen auf die studentische
Situation zu übertragen.
Der Artikel versucht zunächst die eigene Lerngeschichte des Institutes
(Universität Linz, Institut für Unternehmensführung, Forschungsschwerpunkt
Personalwirtschaft) zur Thematik der Selbststeuerung kurz zu skizzieren. Sodann gilt ein
Hauptaugenmerk den theoretischen Implikationen dieses Lernexperimentes, um die eigene
Position zu Fragen der Erwachsenenpädagogik herauszuarbeiten. Schließlich wird das
Design im engeren Sinne, d.h. die praktische Umsetzung beschrieben und kritisch
reflektiert.
Hubert Teml
Der Personzentrierte Ansatz in Schule und Lehrerbildung
47-55
Personzentrierte Begrifflichkeit wird
in der didaktischen Auseinandersetzung zwar häufig verwendet, aber selten in der
Radikalität ihrer ursprüglichen Bedeutung gesehen. Der Paradigmenwechsel von der
"Erziehung zur Beziehung" wird vielfach verharmlost und der Ansatz vor allem auf
eine (Gesprächs-)Technik reduziert. Dies dürfte mit seiner Rezeption in den 70er-Jahren
zusammen, die sich in der Lehrerbildung weniger an der Person als mehr am Training von
"richtigen" Verhaltensweisen orientierte und damit "inkongruent"
vermittelt wurde. Auch die "Inkongruenz" der Institution, die zwar
Persönlichkeitsentwicklung fordert aber nicht fördert, dürfte Ursache für eine
schwindende Bedeutung des Ansatzes in der Schule sein. Lehrer-Bildung" würde aus
personzentrierter Sicht ein stimmiges Konzept erfordern, in der die Entwicklung der
"Lehr-Person" im Zentrum steht und durch ein "lehrerzentriertes
Curriculum" gefördert wird.
Ilse Schneider
Die Bedeutung des Personzentrierten Ansatzes für die Organisationspsychologie 56-63
In der heutigen Managementphilosophie
finden neben den strukturellen Interventionen, die zu einer Betriebsführung notwendig
sind, "sich selbst organisierende Prozesse" als strategische Grundlage flexibler
Unternehmensentwicklung breite Beachtung. In diesem Artikel wird auf die gemeinsamen
philosophischen Wurzeln der naturwissenschaftlichen "Theorien über komplexe
Systeme", konstruktivistischer Ansätze, der aktuellen Organisationspsychologie, und
des personzentrierten Anliegens Rogers hingewiesen. Der folgende Überblick soll den
unbedingten Zusammenhang zwischen Rogersschen Rahmenbedingungen und
selbstorganisatorischen Konsequenzen auf die personelle Eigenverantwortlichkeit und
produktive wirtschaftliche Innovationen verdeutlichen.
Ditta Rudle
Der Personzentrierte Ansatz in der journalistischen Arbeit
64-68
Nicht nur das Vokabel "Interview" verbindet
die journalistische Arbeit mit der therapeutischen oder beratenden, auch das Anliegen:
Kommunikation. Die Berücksichtigung und Anwendung der bekannten Parameter des
Personzentrierten Ansatzes nach Carl R. Rogers erleichtern auch das journalistische
Interview. Durch das Herstellen einer Beziehung wird aus einem beruflichen Zusammentreffen
eine Begegnung. Im Folgenden gehe ich nicht nur auf die Parallelen sondern auch auf die
Unterschiede zwischen therapeutischer/beratender Kommunikation und journalistischem
Gespräch ein und zeige, wie förderlich eine personzentrierte Haltung nicht nur dem Ziel
des Interviews sondern der gesamten Qualität des Journalismus ist.
Christiane Bahr
Entwicklungspsychologische Möglichkeiten im höheren Lebensalter
am praktischen Beispiel des Sozial– und Gesundheitszentrums Gnig 69-75
Ausgehend von entwicklungspsychologischen Überlegungen zum Alter und Altern soll versucht
werden, dessen gerontologische Einbindung in den person- und klientenzentrierten
Handlungskontext des Sozial- und Gesundheitszentrums Gnigl darzustellen. Betont werden
dabei die vielfältigen Förderungsmöglichkeiten von Potentialen und Restkapazitäten im
Alter. Unterstützung und Förderung bedarf sowohl bei rüstigen als auch bei hilfe- und
pflegebedürftigen SeniorInnen eines adäquaten Angebots. Als mögliches Beispiel hierfür
ist die Beschreibung der Tätigkeiten im Sozial und Gesundheitszentrum gedacht.
Renata Fuchs
Personzentrierte Beratung bei
Arbeitslosigkeit 76-80
Vorstellung eines Konzepts personzentrierter Beratung und Kurzpsychotherapie für
arbeitslose Personen, das aus der Praxis entwickelt wurde und versucht, die politischen
und institutionellen Rahmenbedingungen von Arbeitslosigkeit und deren Auswirkungen auf die
Psyche miteinzubeziehen.
Peter F. Schmid
Personale Theologie – personale Seelsorge
Zum Diskurs zwischen Theologie bzw. Seelsorge und dem Personzentrierten Ansatz
81-84
Nach personzentriertem Verständnis geht es nie um
Anwendung, sondern stets um Kreation auf der Basis von Begegnung. Jene von Theologie bzw.
Seelsorge einerseits und Personzentriertem Ansatz bzw. ebensolcher Psychotherapie–
oder Beratungspraxis andererseits eröffnet reiche Felder zur Weiterentwicklung beider
Wissenschaften und Handlungsansätze. Dieser kurze Aufsatz versucht, die Dimensionen
wechselseitiger Herausforderung anhand anthropologischer, erkenntnistheoretischer,
wissenschaftstheoretischer und praxeologischer Parallelen, Differenzen und
Interdependenzen aufzuzeigen.
__________________
Gerhard Stumm
Klienten-/Personzentrierte Psychotherapie in Österreich
5-10
Im Zuge der Arbeiten zum "Handbuch für
Psychotherapie und psychosoziale Einrichtungen" im Jahre 1996 wurden die
Psychotherapeutenliste und in der Folge auch eigens dafür erhobene repräsentative Daten
über die österreichischen Psychotherapeutinnen ausgewertet. Zusätzlich wurden Kennwerte
aus einer jüngst durchgeführten Studie herangezogen (ÖBIG, 1997) und ein Vergleich mit
den Ergebnissen vor einem Jahrzehnt vorgenommen (Jandl-Jager & Stumm, 1988). Im
einzelnen finden sich Angaben zu soziodemografischen (z. B. Alter, Geschlecht),
ausbildungsbezogenen (methodenspezifisch und sonstige berufliche Qualifikation),
versorgungsrelevanten (z. B. regionale Verteilung, freiberufliches Angebot) und
tätigkeitsspezifischen (z. B. Spezialisierungen) Kennzeichen der Berufsgruppe der
Psychotherapeutinnen. Neben einem allgemeinen Überblick werden jeweils die spezifische
Situation und Besonderheiten der Klientenzentrierten und Personenzentrierten
Psychotherapeutinnen (KP, PP) und ihrer Angebote dargestellt und diskutiert.
Die Ergebnisse zeigen, daß - methodenspezifisch gesehen - die Klienten- und
Personenzentrierten Psychotherapeutinnen zusammen nach den systemischen
Psychotherapeutinnen die zweitgrößte Gruppe unter den Psychotherapeutinnen Österreichs
sind. Über ein Viertel aller Personen, die eine Zusatzbezeichnung aufweisen, verfügen
über den Zusatz "Klientenzentrierte Psychotherapie" oder
"Personenzentrierte Psychotherapie". Ihr Durchschnittsalter beträgt rund 45
Jahre. Die Frauen stellen einen Zweidrittelanteil. Hinsichtlich der sonstigen beruflichen
Qualifikation ist der Anteil der Psychologinnen mit gut 40% einzuschätzen. Der
Organisierungsgrad im Berufsverband (ÖBVP) ist mit über zwei Drittel bemerkenswert hoch.
Regional betrachtet sind Klientenzentrierte Psychotherapeutinnen (in dieser Reihenfolge)
vorwiegend in Wien, Tirol, Salzburg, Steiermark und Kärnten tätig, wobei speziell der
Anteil in Tirol und allgemein in den Landeshauptstädten weit über dem Schnitt liegt. Von
Belang und einer näheren Betrachtung zu unterziehen ist ferner, daß Klientenzentrierte
Psychotherapeutinnen in einem höchst signifikanten Ausmaß häufiger als
Psychotherapeutinnen aus anderen Richtungen in einer zweiten psychotherapeutischen Methode
ausgebildet sind. Diagnosen- und zielgruppenspezifische Arbeitsschwerpunkte sind
auszumachen: Psychosomatische Erkrankungen, Neurosen, Borderlinestörungen, Arbeit mit
Paaren, Familien und Kindern sowie Supervision.
Walter Kabelka
Bericht vom Symposium der ÖGwG im Mai 1998 85f
In fachlicher Hinsicht wird ein Überblick über die
Themen und Referate des Symposiums in Linz gegeben, wobei näher auf die Bereiche
Diagnostik und Selbst-Begriff eingegangen wird. Es folgen Schilderungen und Kommentare zu
Ereignissen auf der Ebene kollegialer fachlicher und persönlicher Kontakte und
Überlegungen zu Ereignissen und Möglichkeiten vereinsinterner wie -übergreifender
Kommunikation und Kooperation.
Peter F. Schmid
» to further cooperation
between person-centred institutions in Europe in the field of psychotherapy and counseling
...«
Zur Gründung des Network of the European Associations for Person-Centred Counselling and
Psychotherapy (NEAPCCP)
87-89
Ein Jahr nach der Gründung des Weltverbandes - siehe
PERSON 2 (1997) - wurde im vergangenen September beim traditionellen europäischen
Verbändetreffen ein personzentriertes Netzwerk europäischer Vereinigungen gegründet.
Damit ist der Personzentrierte Ansatz in Psychotherapie und Beratung nun auch
gesamteuropäisch organisiert. Mittlerweile ist das NEAPCCP Mitglied der EAP, des
europäischen Dachverbandes für Psychotherapie. In diesem Beitrag werden Motive,
Prinzipien und Struktur des Dachverbandes erläutert. Die Statuten werden im nächsten
Heft dokumentiert.
Internationale Termine
zusammengestellt von Peter F. Schmid 90
Tagungen, Workshops, Symposia
Aktuelle Informationen
von APG und ÖGwG
91-93
Neuerscheinungen und weitere aktuelle
Bücher zum Personzentrierten Ansatz
zusammengestellt von Peter F. Schmid
U3

 Heft 2 | 1999
Heft 2 | 1999
Editorial
Peter Frenzel 99f
Michael
Gutberlet
Die Entfaltung von Personal Power im Personzentrierten
Ansatz
Vortrag zum ÖGwG-Symposium 21.-23. Mai 1998 in Linz 101-109
Power wird in diesem Text verstanden als das Erfahren einer inneren seelischen
Kraft, die im Rahmen personzentrierter Arbeit dann gemacht werden kann, wenn ein
Wachstumsschritt stattfindet. Als Beispiel wird herausgearbeitet, wie Power in Momenten des
Angenommen-Seins erfahren werden kann und wie sie sich aus dem Gewahrsein heraus
bisweilen einstellt. Die Frage wird diskutiert, wie sich der Einbezug von
Therapietechniken auf die
Entfaltung dieser Kraft auswirkt, und es werden einige Bedingungen formuliert,
unter denen Technik-Anwendung und personzentrierte Haltung miteinander vereinbar
sind. Die
Überlegungen werden aus der persönlichen und professionellen Erfahrung
des Autors heraus dargestellt und entwickelt und mit der Theorie und Praxis von
Rogers verknüpft.
Stichwörter: Power des
personzentrierten Ansatzes, Erfahrung, Wertschätzung/Akzeptanz,
Kongruenz/Gewahrsein, Personzentrierte Haltung,
Integration anderer Therapiemethoden.
Ed
Kahn
The Intersubjective Perspective and the
Person-Centered Approach
Are They One at Their Core? 110-121
This article reviews the change from a oneperson to a twoperson psychology in
psychoanalysis. In particular,
Robert Stolorow’s intersubjectivity theory is presented and then contrasted
with the clientcentered approach to therapy.
It is concluded that contemporary clientcentered therapy is a twoperson
psychology, and that welltrained clientcentered therapists do reflect on their
own subjectivity and how it influences the client.
With their important similarities it seems that the clientcentered and
self psychology approaches are one at their core.
Self psychology has more elaborate theorizing about the therapy process,
while the clientcentered approach is interested in applying its principles
outside of therapy so that people can live more constructively.
Keywords: Intersubjectivity theory, self psychology, therapy process, two
person psychology.
Hermann
Spielhofer
Empathie, hermeneutisches Verstehen oder
Konstruktion?
Das Erkenntnisverfahren in der Klientenzentrierten Psychotherapie
122-130
Rogers war zutiefst von der Möglichkeit
unmittelbarer und direkter Erfahrung überzeugt, sodass er es offensichtlich
nicht für notwendig erachtete, das Erkenntnisverfahren der klientenzentrierten
Psychotherapie, das empathische Verstehen, methodisch zu begründen. Er ging
davon aus, dass wir durch unmittelbares, einfühlendes Miterleben einen direkten
Zugang zum Erleben des Klienten erhalten und seinen „inneren Bezugsrahmen“
genau wahrnehmen können. W. Keil hat versucht den Empathie-Begriff Rogers' mit
der hermeneutischen Methode zu verbinden und dafür den Begriff der
„hermeneutischen Empathie“ verwendet. Entsprechend dem hermeneutischen
Verfahren können wir die (Erfahrungs-)Welt des anderen nicht unmittelbar
betreten, sondern immer nur ausgehend von unseren eigenen (Vor-)Erfahrungen und
durch Analogieschlüsse die Erlebnisse des anderen nach-empfinden, wie dies vor
allem W. Dilthey und H. Gadamer dargestellt haben.
Dieser hermeneutische Verstehensprozess bezieht sich jedoch nur auf die dem
Klienten zugänglichen, d. h. bewussten Selbstanteile seiner Erfahrung oder
bestenfalls auf den „Rand der Gewahrwerdung“. Die abgewehrten oder
verzerrten, inkongruenten Erfahrungsbereiche können damit nicht erfasst werden,
da sie dem Klienten selbst nicht zugänglich sind. Hier versucht Keil das
„szenische Verstehen“ des Analytikers A. Lorenzer einzubeziehen, wobei im
Rahmen des Übertragungs-Gegenübertragungs-Prozesses, analog den
vorsprachlichen sensomotorischen Austauschprozessen in der frühen
Mutter-Kind-Dyade, die unbewussten, sprachlosen Interaktionserfahrungen erfasst
und symbolisiert werden können.
Für J. Finke gruppiert sich therapeutisches Handeln um die beiden
Grundpositionen Empathie und Interaktion; dabei geht es um identifikatorische
Teilhabe einerseits und um dialogische Gegenüberstellung andererseits. Aber
auch bei Finke bleibt offen, wie wir den Zugang zum Erleben des Klienten,
insbesondere zu den abgewehrten und verzerrten Erfahrungen finden; wie aus der
gemeinsamen Interaktion mit dem Klienten jene Begriffe und Erlebnisfiguren
herausgelöst werden, die dann auf dem Raster einer Persönlichkeitstheorie oder
Störungslehre eingetragen und dargestellt werden können.
Die methodische und wissenschaftstheoretische Begründung des
Erkenntnisverfahrens ist nicht nur deswegen von Bedeutung, um die
klientenzentrierte Psychotherapie als wissenschaftliche Methode auszuweisen,
sondern auch für das therapeutische Verfahren selbst, denn Verstehen und Verändern
sind im therapeutischen Prozess nicht zu trennen.
Stichwörter: Empathie, Epistemiologie, Hermeneutik, Interpretation,
Konstruktion, Phänomenologie, szenisches Verstehen
Jobst Finke
Das
Verhältnis von Krankheitslehre und Therapietheorie in der
Gesprächspsychotherapie 131-138
Es wird davon ausgegangen, daß
das Störungskonzept von Rogers eine Therapietheorie verlangt, die den
therapeutischen Prozeß als eine systematische und hermeneutisch zu definierende
Resymbolisierung beschreibt. Rogers selbst geht therapietheoretisch jedoch eher
vom Wachstumsmodell aus, das er später gewissermaßen beziehungstheoretisch ergänzt.
So sind innerhalb des personenzentrierten Ansatzes 3 Ausrichtungen entstanden,
die sich jeweils auf Rogers berufen können: Diejenige, die das Aktualisierungs-
bzw. das Wachstumsmodell betont, diejenige, die vom Inkongruenzmodell und dem
damit verbundenen Konzept der Symbolisierungsstörung ausgeht und diejenige, die
sich an dem Begegnungskonzept des späten Rogers orientiert. Die störungs- und
therapietheoretischen Besonderheiten dieser 3 Ausrichtungen werden dargestellt
und es wird gefordert, auch konzeptuell diese 3 Ansätze stärker miteinander zu
verbinden.
Stichwörter: Störungs- und
Therapietheorie der personenzentrierten Psychotherapie, Wachstums- und
Beziehungstheorie, Inkongruenzmodell, Symbolisierungsstörung
Peter F. Schmid
Person-Centered
Essentials — Wesentliches und Unterscheidendes
Zur
Identität personzentrierter Ansätze in der Psychotherapie
139-141
Hier wird ein
Versuch vorgestellt, Personzentrierte Psychotherapie zu definieren, kurz zu
charakterisieren und, sie von anderen Psychotherapieformen abgrenzend, in ihren
essenziellen Merkmalen zu beschreiben.
Stichwörter: Personzentrierte
Psychotherapie, Personzentrierter Ansatz: Definition, wesentliche Merkmale
Rezensionen:
Lore
Korbei
Eugene T. Gendlin,
Focusing – orientierte Psychotherapie. Ein Handbuch der erlebensbezogenen
Methode, München, Pfeiffer, 1998 • 142f
Wolfgang
W. Keil
Peter
F. Schmid, Personzentrierte
Gruppenpsychotherapie. Ein Handbuch, Bd. I: Solidarität und Autonomie,
EHP,
Köln, 1994 • 144f
Hans
Snijders
Peter
F. Schmid,
Personzentrierte Gruppenpsychotherapie in der Praxis - Ein
Handbuch. Bd. II: Die Kunst der Begegnung, Junfermann, Paderborn, 1996
• 146-149
Jobst Finke
Peter
F. Schmid, Im Anfang ist Gemeinschaft. Bd. III: Personzentrierte
Gruppenarbeit in Seelsorge und Praktischer Theologie, Kohlhammer, Stuttgart,
1998 • 150f
Gerhard
Stumm
Jobst
Finke, Beziehung und Intervention. Interaktionsmuster, Behandlungskonzepte
und Gesprächstechnik in der Psychotherapie,
Thieme, Stuttgart, 1999 • 152f
Person-Centered
Association in Austria (PCA)
Erklärung
psychotherapeutischer Vereine zur politischen Situation
154
Network of
the European Associations for Person-Centered Counselling and Psychotherapy (NEAPCCP)
Statutes – Members – Board
156-158
Lore
Korbei
Vergabe des 1. Internationalen Sigmund-Freud-Preises
für Psychotherapie der Stadt Wien an Prof. Dr. Sylvester Ntom Madu
155

 Heft
1|2000
Heft
1|2000
Ulrike Diethardt / Christian
Korunka
Editorial
3
BEITRÄGE
Maureen
O'Hara
Moments of Eternity
What Carl Rogers has to Offer Brief Therapists 5-17
The article gives a
short overview over the phases of development of
Person-Centered Psychotherapy. Emphasis is given
on Carl Rogers’ approaches on time-limited
treatment. It is argued that Person-Centered
psychotherapy both, in its theory an in its
practice, can legitimately be considered as a
brief therapy. Characteristics of successful
therapeutic moments are discussed. As a case
example, a brief therapy including specific
therapeutic moments is presented. It is argued
that “relational empathy” is a key agent of
therapeutic movement, especially in group settings.
Martin van Kalmthout
Towards an integrated person-oriented psychotherapy
18-22
In this article a
distinction is made between person-centered and
person-oriented psychotherapy. Person-centered
therapy is considered a separate school of
therapy, while person-oriented therapy is
considered as a metatheory for all psychotherapy.
It is argued that the latter is more in keeping
with the spirit of Carl Rogers than the first.
Brian Thorne
Spirituelle Verantwortung in einem säkularen Beruf
23-31
Der Autor plädiert
leidenschaftlich für das Ernstnehmen der
„spirituellen Dimension“ der Tätigkeit von
Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Der Begriff
der Spiritualität bezieht sich dabei auf das
entscheidende Fundament menschlichen Seins. In ihr
liegt demzufolge der Quelle der Identität der
Person. Es wird die Behauptung aufgestellt, dass
Therapeuten diese Dimension ihrer Arbeit, „die
spirituelle Berufung“, nicht mehr ignorieren
können und dass diejenigen, die sie akzeptieren,
bei allen Unterschieden indirekt jene Rolle
einnehmen, die früher die Priester innehatten: die
Mitmenschen auf deren Suche nach Sinn und Wahrheit
zu begleiten. Therapie ist daher nicht als
Psychotechnik, sondern als neue Art der Seelsorge
auf der Basis der Gegenwärtigkeit in der Beziehung
zu begreifen.
Madeleine Garbsch
Geschichte der Psychotherapieforschung
Der Beitrag des Personzentrierten Ansatzes
32-42
Der Artikel befasst
sich mit der Geschichte der
Psychotherapieforschung unter besonderer
Berücksichtigung der Personzentrierten
Psychotherapie. Richtlinien, Ergebnisse und state
of the art von Psychotherapieforschung werden
dargestellt. Insbesonders wird Carl Rogers’
Beitrag zur Forschungsentwicklung gewürdigt.
Aktuelle Forschungsanliegen werden aufgezeigt und
hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit
personzentrierten Annahmen diskutiert.
Brigitte Pelinka
Klientenzentrierte Kindertherapie
Neue Aspekte vor dem Hintergrund der Persönlichkeitstheorie von Carl
Rogers 43-51
In Gesprächen mit
Kolleginnen fällt mir immer wieder das Erstaunen
daraüber auf, dass die konsequente Einhaltung der
Rogersvariablen in der Kindertherapie schnelle und
anhaltende Veränderungen bei den Kindern bemerken
lässt. Selbst unter ungünstigen Bedingungen
scheint das bloße „mit den Kindern spielen“
Erstaunliches zu bewirken. Mein Interesse gilt
zuerst einer Frage, die sich durch meine Erfahrung
in der Arbeit mit Kindern aufgetan hat. Wie kann
ich mir erklären, dass die Grundvariablen, die ich
seit Jahren in der Erwachsenentherapie anwende,
bei Kindern eine noch deutlichere Wirkung auf
deren Entwicklungsprozess ausüben? Es schien
lohnenswert, die Gründe dafür bei Rogers selbst zu
suchen. Das Kernstück dieses Beitrags ist der
Versuch, anhand der Rogers’schen
Persönlichkeitstheorie Hypothesen zu deren
Relevanz in der Kindertherapie zu entwickeln. Die
Klientenzentrierte Psychotherapie für Kinder und
Jugendliche hat eine ungefähr siebzig Jahre lange
Geschichte. In dieser Zeit hat sich das
Verständnis von Beziehung in der
Klientenzentrierten Psychotherapie
weiterentwickelt und die Kindertherapie hat auch
von dieser Entwicklung profitiert. Die praktische
Bedeutung dieser Entwicklung wird hier anhand des
Konstruktes der „Interaktionsresonanz“ von Behr
dargestellt.
Christine Wakolbinger
Der Therapieprozess in der Personzentrierten Kindertherapie
52-62
In diesem Aufsatz
hält die Autorin den Therapieverlauf einer
Personzentrierten Kindertherapie in ihren
wesentlichen Schritten fest. Der Schwerpunkt wird
dabei auf die sich laufend verändernde Beziehung
zwischen Kind und Therapeutin gelegt. Weiters
werden charakteristische Merkmale der einzelnen
Therapiephasen anhand konkreter Beispiele
herausgearbeitet.
BERICHTE
Mary Bourne Kilborn
The Second PCA Colloquium, Kranichberg, Austria, 10-12 July 1999
A
Personal Impression 63-65 •
read
this article online
Helmut Schwanzar
Jubiläumssymposium
2000 in Salzburg
30 Jare GwG - 25 Jahre ÖGwG - 20 Jahre SGGT - 20 Jahre APG
67f
Rezensionen
Björn
Süfke
Wolfgang
Neumann, Spurensuche als psychologische Erinnerungsarbeit
69f
Lore Korbei
Eugene T. Gendlin / Johannes
Wiltschko, Focusing in der Praxis. Eine schulenübergreifende Methode für
Psychotherapie und Alltag 70f
Literatur
Peter F. Schmid
Neuerscheinungen und weitere aktuelle Bücher und
CD-ROMs zum Personzentrierten Ansatz und zur Experienziellen Psychotherapie

 Heft 2 | 2000
Heft 2 | 2000
•
Person-/Klientenzentrierte Supervision
Peter F. Schmid / Hermann Spielhofer
Editorial 3-4
Christian
Korunka / Joachim Sauer / Kornelia Steinhardt / Brigitte Lueger-Schuster
Der Stellenwert des Personzentrierten Ansatzes in
der Supervision
Eine
empirische Bestandsaufnahme 5-14
Die
Supervision befindet sich in Österreich auf dem Weg einer zunehmenden
Professionalisierung. Erkennbar wird dies z.B. durch die Gründung und die
Bestrebungen der Österreichischen Vereinigung für Supervision (ÖVS) zur
Entwicklung eines Berufsbildes von Supervision, aber auch durch die Definition
von Kriterien für Supervision im Rahmen der Psychotherapie durch den
Berufsverband der Psychotherapeuten (ÖBVP). Eine analoge Entwicklung einer
Professionalisierung ist ebenfalls für die Supervision im Bereich des
Personzentrierten Ansatzes erkennbar.
Im vorliegenden Beitrag wird der Stellenwert des Personzentrierten Ansatzes auf
der Basis einer Analyse von Daten aus der Studie „Supervision in Österreich”
beurteilt. Insgesamt liegen in dieser Repräsentativerhebung die Einschätzungen
von 636 Supervisoren/innen vor, von denen 99 eine abgeschlossene person-/bzw.
klientenzentrierte Ausbildung (Psychotherapie bzw. Beratungsausbildung)
besitzen.
Es
bestätigt sich, dass der Person-/Klientenzentrierte Ansatz gut in der österreichischen
Supervisionsszene vertreten ist. Es kann gezeigt werden, dass die berufliche
Sozialisation das Selbstverständnis und die Ausübung der Supervision bestimmt.
Die Supervisoren/-innen mit person-/klientenzentrierter Ausbildung weisen
aufgrund ihrer Sozialisation ein eher „therapeutisches” Selbstverständnis
auf, was u.a. in ihren sonstigen Tätigkeitsschwerpunkten, den
Supervisionssettings, den Inhalten und den Orten der Supervision zum Ausdruck
kommt.
Peter F. Schmid
Begegnung und Reflexion
Personzentrierte Supervision als Förderung der Person im Spannungsfeld von Persönlichkeitsentwicklung
und Organisation 15-27
Drei grundlegende Positionen
zur Supervision werden in diesem Beitrag behauptet und begründet:
1. Eine Diskussion über Supervision ohne Diskussion über das zugrunde liegende
Menschenbild ist intellektuell unredlich. Die anthropologische Frage ist
explizit zu stellen, will man verantwortungsbewusst an das Thema Supervision und
die Arbeit als Supervisor bzw. Supervisorin herangehen. Aus personzentrierter
Sicht kommt dabei die Frage nach der Person in den Blick.
2. Ein Supervisionsverständnis, das vorwiegend von Effizienz und Methodenfrage
im herkömmlichen Sinn geprägt ist, ist menschlich unredlich. Supervisoren müssen
sich der Frage stellen, wie sie ihre Rolle grundsätzlich definieren. Aus
personzentrierter Sicht ist das die Frage, wie von den Supervisoren die Aufgabe
eines Facilitators kunstgerecht wahrgenommen werden kann.
3. Theorie und Praxis von Supervision, die sich dem Diskurs über das politische
Selbstverständnis des supervisorischen Handelns nicht stellen, sind ethisch
unredlich. Aus personzentrierter Sicht ist Supervision keine Technologie,
sondern die Kunst von Begegnung und Reflexion in einem gesellschaftspolitischen
Zusammenhang. Sie ist, was immer sie sonst noch ist, eine sozialethische
Disziplin.
Dem weit verbreiteten Ansatz, Supervision als Methode zu sehen, wird hier die
personzentrierte Position gegenübergestellt, Supervision als jene kunstvolle
Beziehungsgestaltung zwischen Supervisor(en) und Supervisand(en) zu verstehen,
die durch Begegnung und Reflexion zur
authentischen, menschengerechten und emanzipatorischen Gestaltung der
Arbeitswelt der betroffenen Personen, Teams und Organisationen in ihrer
Wechselbeziehung beizutragen imstande ist.
Peter Frenzel
Personzentrierte Supervision:
Entwicklung
durch dialogische Kreation funktionaler Wirklichkeiten in einer Umwelt der
Organisation 28-39
In diesem Beitrag werden
Aspekte aufgezeigt, wie Personzentrierte Supervision die aufgabenkonforme
Reflexion beruflicher Situationen als Balance zwischen personaler und
organisationaler Ebene realisieren kann. Ausgehend von einer spezifischen
Auffassung des Personzentrierten Ansatzes, die konstruktivistische und
systemtheoretische Aspekte berücksichtigt, gestaltet sich das Aufgabenverständnis
des Personzentrierten Supervisors als das eines hilfreichen „Facilitators“,
der mit weitgehendem Vertrauen in die Selbstorganisationsfähigkeiten der Person
oder des Teams für manche Aspekte zeitgemäßen Managements lernförderliche
Vorbildwirkungen und konstruktive Entwicklungsprozesse entfalten kann. Rund um
diese Thesen wird zunächst das Interventionsfeld und der Aufgabenbereich von
Supervision in Organisationen in einer Skizze dargestellt und dann einige
ansatztypische Kernpunkte in ihrer Bedeutung und ihrem Potenzial für
supervisorisches Handeln in Organisationen beleuchtet. Konsequenzen für die
Ausbildung personzentrierter Supervisor/inn/en werden angedeutet.
Beatrix Mitterhuber
Person als Schaltstelle von Veränderungsprozessen
Eine Brille der mehrdimensionalen Betrachtung 40-43
Ist
Veränderung und Entwicklung einer Institution denkbar ohne dass die Person sich
für Veränderungen und Entwicklung öffnet? Organisationen sind nicht aus sich
selbst entstanden, sondern sind von den steuernden Eingriffen von Personen abhängig.
Dieser Frage und den Anforderungen an das berufliche und persönliche
Selbstkonzept von Personen und dem Selbstverständnis von Organisationen soll in
diesem kurzen Artikel nachgegangen werden.
Das Gelingen von Veränderungsprozessen ist von der Bereitschaft und Fähigkeit
von Personen, flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, abhängig. Ebenso ist
die Bewältigung dieser von der ausreichenden Berücksichtigung und der
Bereitstellung von Ressourcen durch die Organisation in großem Maße bedingt.
Die Ausgewogenheit zwischen Stabilisierungstendenzen und Änderungstendenzen
sollen auf allen strukturellen Ebenen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen,
um eine entsprechende Selbstkonzepterweiterung zu ermöglichen und einen adäquaten
Umgang mit den Anforderungen zu entwickeln.
Helmut Schwanzar
Empathie als
Veränderungskonzept und Erkennungsinstrument 44-48
Das
empathische Verstehen von Personen in ihrer konkreten Arbeitssituation ist ein
zentraler Punkt, der Veränderungsprozesse in Supervisionen ermöglicht und in
Gang setzt. Dieser Prozess
wird anhand von sechs Punkten beschrieben. Die sich ständig wiederholende
Abfolge von Erkenntnis und Entwicklung verändert ursprünglich vorhandene
Inkongruenzen und führt die Personen und die Organisation als ganzes zu immer
mehr Kongruenz, Flexibilität und Authentizität.
Wolfgang Schrödter
Wer oder was bringt soziale
Gebilde in Bewegung?
Überlegungen zu Konservativismus, Wandel und Entwicklung
in sozialen Gefügen 49-55
Supervision und Beratung führen
hinein in soziale Gefüge, die gemäß einer eigenen Logik operieren. Wir
betreten damit ein neues, von der therapeutischen Arbeit zu unterscheidendes
Terrain. Anhand von Beispielen und theoretischen Überlegungen werden Gedanken
zur Methodik und Praxis des Verstehens institutioneller und
organisationsbezogener Prozesse vorgestellt.
Geerd Schweers
Personzentrierter
Ansatz und Supervision 56-61
Der
Artikel untersucht einige Aspekte eines personzentrierten Verständnisses von
Supervision. An einem Beispiel werden die Grenzen, aber auch Veränderungsnotwendigkeiten
von personzentrierten Schlüsselbegriffen erläutert.
Thesen
zur inhaltlichen und methodischen Veränderung werden vorgestellt. Der
Vorstellung einer Rahmenmetapher in der Supervision folgen einige methodische
Anregungen.
Peter F. Schmid
World Association
for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling
Das Selbstverständnis. Die neuen Statuten
62-64
PERSON
dokumentiert die Präambel, die Prinzipien und die Ziele der definitiven
Statuten des „Weltverbands
für Personzentrierte und Experienzielle Psychotherapie und Beratung“,
die nach ausführlicher Diskussion von der letzten Generalversammlung in Chicago
im Juni 2000 ebenso einstimmig beschlossen wurden wie die Änderung des
bisherigen, provisorischen Namens des Weltverbandes. Das Europäische Netzwerk
schloss sich an.
Rezension
Wolfgang
W. Keil
Sander,
Klaus, Personzentrierte Beratung. Ein Arbeitsbuch für Ausbildung und Praxis
65
Link:
Tagung "Veränderungskonzepte
in der Supervision", veranstaltet von IPS der APG, ÖGwG und ÖBVP,
12.-13. 11. 1999, Wien, Am Spiegeln

 Heft 1|2001
Heft 1|2001
Wolfgang
W. Keil / Sylvia Gaul
Editorial
3
Hermann Spielhofer
Organismisches
Erleben und Selbst-Erfahrung
Ein Beitrag zur Diskussion der anthropologischen
und persönlichkeitstheoretischen Grundlagen im
Personzentrierten Ansatz 5
Die
vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, die Konzepte Rogers' sowie deren
anthropologische und philosophische Grundlagen im Lichte aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Paradigmen neu zu diskutieren. Der zentrale
Aspekt im Menschenbild Rogers' und die Grundannahme seiner Theorie der Persönlichkeit
ist der Begriff des „Organismus“ und der darin wirksamen
„Aktualisierungstendenz“. Trotz der Bedeutung für die Theoriebildung bleibt
dieses Konzept allerdings vage und zum Teil widersprüchlich. Vor allem wird bei
Rogers nicht klar unterschieden zwischen dem Organismus als körperlich-biologischem
Substrat und dem organismischen Erleben als psychologische Kategorie.
Der Begriff des „Organismus“ als Erfahrungskategorie soll hier unterschieden
werden von dem des Körpers, analog zur phänomenologischen Differenzierung in Körper
und Leib, in an sich und für sich Seiendes und sich ausschließlich auf das (organismische)
Erleben beziehen. Die Entwicklung und Ausprägung des organismischen Erlebens
bzw. unserer Bedürfnisse und Emotionen, als wesentlicher Aspekt der
Konstituierung des Individuums, erfolgt im Rahmen der Vermittlung von
menschlicher Natur und Erfahrung, von Kausalität und Intentionalität und damit
wird auch die Leib-Seele-Problematik in einen anderen kategorialen Rahmen
gestellt. Die Aktualisierungstendenz wird demgegenüber als „übergeordnetes
Sinnprinzip“ gesehen, bei der es ganz allgemein „um die Natur des Prozesses
geht, den wir Leben nennen“ (Angyal, 1941) sowie als zentraler Aspekt im
Menschenbild des Personzentrierten Ansatzes.
Außerdem soll hier neben dem „Selbst“ als Objekt unserer (Selbst-)Erfahrung
oder dem „phänomenalen Feld“ ein „Ich“ oder Subjekt als eigene Instanz
diskutiert werden, im Sinne eines sinnstiftenden Zentrums und als Voraussetzung
von Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Das Selbst wird als eine
Konstruktion betrachtet, die das Subjekt aus bruchstückhaften, zum Teil
präverbalen und nicht symbolisierten Erfahrungen, Erinnerungsbildern,
Bedürfnissen usw. gestaltet. Die Auswahl und Bewertung dieser Elemente des
Selbstbildes erfolgt auf der Basis unseres Lebensentwurfs, unserer
Intentionalität.
Gerhard Stumm
Der Personzentrierte Ansatz und die Selbstpsychologie 19
Nachdem eingangs Motive des Autors für
den vorliegenden Vergleich dargelegt werden, befasst sich der Beitrag mit
einigen biographischen Aspekten der beiden Gründerpersönlichkeiten, die auch
Hinweise auf ihre theoretischen Schwerpunktsetzungen liefern. Daran knüpfen
sich Betrachtungen zum philosophischen Hintergrund der beiden Ansätze, ihre
persönlichkeitstheoretischen Konzeptionen (vor allem zum Verständnis des
Selbst, aber auch von Aggression und Sexualität) und eine therapietheoretische
Skizze (vor allem zur Rolle der Empathie und zur Einstellung zu Übertragung und
Deutung), die auch das Verhältnis von Beziehung und Technik illustrieren. Die
Darstellung zeigt, dass neben signifikanten Unterschieden in Theorie und Praxis
auch einige bedeutsame Verwandtschaften bestehen. Die Selbstpsychologie, die
sich als moderne Psychoanalyse versteht, bezieht dabei z.B. im Erfahrungsbezug
und mit der hohen Priorität der Empathie eine Position, die Rogers bereits
einige Jahrzehnte früher eingenommen hat. Schließlich wird der Versuch
unternommen, einige Konzepte der Selbstpsychologie herauszusondern, die für die
Klientenzentrierte Psychotherapie wertvolle Anregungen und Bereicherungen
bieten.
Irmgard
Fennes
Im Prozess der Wandlung
Spirituelle Aspekte in der Personzentrierten
Psychotherapie 32
Der Personzentrierte Ansatz
orientiert sich an einer Kraft, die potenziell Wandlung und Entwicklung fördert
– eine evolutionäre Kraft, die nach Erhaltung und Entfaltung des Lebendigen
drängt. Ich gehe der Frage nach, was passiert, wenn wir uns der
Aktualisierungstendenz überlassen, und beschreibe, dass dies zu Erfahrungen der
Transzendenz und zu Spiritualität führen kann.
In meinem Leben nimmt Spiritualität einen zentralen Platz ein, und meine
therapeutische Arbeit hat sich dadurch verändert. Ich beleuchte hier einen
wesentlichen Ausschnitt meiner persönlichen und beruflichen Entwicklung. Es
leitet mich die Überzeugung, dass die Person der Psychotherapeutin einen
bedeutenden therapeutischen Faktor darstellt.
Ich stelle fest, dass es mir Mut abverlangt, meine sehr persönlichen Gedanken
zum Thema Spiritualität, und wie ich sie in Bezug zur Personzentrierten
Psychotherapie sehe, zu veröffentlichen. Es ist eine Angelegenheit des Herzens,
nicht in erster Linie des Verstandes, und ich bewege mich in diesem Artikel an
der Grenze des Aussprechbaren. Ich hoffe damit
unter Personzentrierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten einen
Gedanken- und Erfahrungsaustausch zur vorliegenden Thematik anzuregen.
Elisabeth
Zinschitz
Prä-Therapie – Eine Antwort auf eine lange nicht beantwortete Frage
Die Klientenzentrierte Psychotherapie in der Arbeit mit psychisch kranken oder
geistig behinderten Menschen 44
Den
Lesern wird hier eine Einführung in die Prä-Therapie von Garry Prouty geboten.
Diese Vorgehensweise führt uns dort, wo die klientenzentrierte Theorie in Bezug
auf die erste von Rogers formulierte Bedingung für therapeutische Veränderung
offen geblieben ist, weiter, indem sie die Herstellung und Festigung von
psychologischem Kontakt ermöglicht und so einen Zugang zu Klienten mit
psychotischem Erleben oder kognitiven Behinderungen bietet. Darüber hinaus wird
dargestellt, wie die prä-therapeutischen Reflexionen auch als eine Form von früher
empathischer Resonanz wirksam sind.
Garry
Prouty
Carl Rogers und die experienziellen Therapieformen: eine Dissonanz?
52
Anlässlich
der Auseinandersetzungen bezüglich der Schaffung übergreifender
Organisationen, die mittlerweile u. a. auch zur Umbenennung unseres
Weltverbandes (in: "Weltverband für Personzentrierte und Experienzielle
Psychotherapie und Beratung") geführt haben, äußert Garry Prouty seine
Sorge darüber, dass die Klientenzentrierte Therapie von einem experienziellen
"Zeitgeist" absorbiert und ihr Wesen darin eines Tages aufgelöst
werden könnte. Die Betonung experienzieller Faktoren statt der Beziehung als
wesentlichem therapeutischen Faktor stellt für Prouty einen mit Rogers nicht
mehr zu vereinbarenden Paradigmenwechsel dar.
In seiner Argumentation erläutert Prouty zunächst, dass Rogers zwar
durchaus von Gendlins experienziellem Konzept beeinflusst ist, er aber "experiencing"
immer als Resultat (abhängige Variable) der therapeutischen Bedingungen
(Grundhaltungen) und nicht als Ursache (unabhängige Variable) der
therapeutischen Veränderung verstanden hat. Als weiteres Wesensmerkmal des
Konzepts von Rogers wird die nicht-direktive Haltung des Therapeuten
herausgestellt. Die Tatsache, dass Rogers die nicht-direktive Haltung nicht
definitiv in seine Therapietheorie eingebaut hat, wird von Prouty als äußerst
bedeutsames historisches Versäumnis eingestuft. Auf theoretischer Ebene wird es
dadurch grundsätzlich möglich, die Grundhaltungen, solange sie jedenfalls
gegeben sind, mit Techniken und Methoden zu kombinieren.
Als prominentesten Vertreter der experienziellen Methoden erläutert Prouty in
der Folge kurz den prozess-experienziellen Ansatz von Greenberg, Rice &
Elliott und stellt dabei dessen Prozessdirektivität in den Mittelpunkt. Seine
Analyse dieses Ansatzes ergibt dann vor allem eine technisch-diagnostische
Ausgerichtetheit des Therapeuten, die einer vollen empathischen Ich-Du-Beziehung
nicht entspricht, sowie einen phänomenologischen Reduktionismus, bei welchem
das Experiencing der Person und nicht ihr Selbst insgesamt in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit gerückt wird.
Mit seiner Darstellung möchte Prouty keinesfalls die Wirksamkeit des
prozess-experienziellen Ansatzes bezweifeln, wohl aber dessen Dissonanz zum
Konzept von Rogers aufweisen bzw. eine Diskussion dieser Thematik einleiten.
Godfrey
T. Barrett-Lennard
Levels of loneliness and connection: Crisis and possibility
58
In
diesem Artikel beschreibt Barrett-Lennard verschiedene Formen von Einsamkeit auf
der individuellen Ebene, auf der Ebene enger Beziehungen sowie auf der Ebene der
Zugehörigkeit zu größeren Gemeinschaften und diskutiert anschließend Aspekte
und Möglichkeiten der Heilung auf allen diesen Ebenen. Zu Beginn unterscheidet
er zwischen einem Mit-sich-selbst-Sein einerseits als positiver Form der
Einsamkeit und einer schmerzhaften Einsamkeit andererseits. Beide Zustände sind
nicht absolut durch die An- bzw. Abwesenheit eines Anderen bedingt.
Im Folgenden stellt er drei verschiedene Arten von Einsamkeit dar:
1) Selbstentfremdung,
wobei der Mensch nicht mit sich selbst in Kontakt ist, sich innerlich gespalten
fühlt und einen Sinnverlust sowie einen Verlust des Selbst erlebt.
a. Eingeengte (trichterähnliche) Selbst-Wahrnehmung. Die Bewertungsbedingungen
haben ein Selbstkonzept entstehen lassen, das nicht immer mit dem Erleben übereinstimmt.
Das führt zu Inkongruenz (Angst-, Schuldgefühle). Im positivem Fall kann es zu
Wachstum führen, da es uns dazu veranlasst, etwas zu unternehmen.
b. Sinnverlust,
Machtlosigkeit, Verzweiflung, wie sie durch einen Verlust der Existenzbasis oder
einer wichtigen Person, durch massive körperliche Veränderungen oder durch Veränderung
der Umgebung entstehen.
c. Akuter
Selbstverlust in Form einer Schizophrenie oder einer ähnlichen Form des
Zusammenbruchs.
d. Gefühl der
Leere oder eines nie gestillten Hungers nach Identität, nach einem Ich mit
bestimmten Eigenschaften und einer kontinuierlichen Orientierung.
2) Zwischenmenschliche
Einsamkeit
Unsere persönliche Identität ist immer mit wichtigen Beziehungen
verbunden. Unser Bedürfnis nach Liebe und Zuwendung bedingt zugleich das
Potential für die Deprivation der Sehnsucht nach einer engen Verbindung. Mangel
an Erfahrungen mit Beziehungen führt nicht nur dazu, dass wir Anderen als
Fremden gegenübertreten, sondern auch dass wir dem Prozess des Kennenlernens
und Beziehung-Aufbauens fremd gegenüberstehen (ohne uns dessen bewusst zu
sein). Heutzutage entstehen oft „funktionelle Beziehungen“, die nicht um
ihrer selbst willen bestehen, sondern für einen gewissen Zweck, was die
Einsamkeit verstärkt.
3)
Einsamkeit auf der Gemeinschaftsebene, das Gefühl, nicht zu einer größeren
Gemeinschaft zu gehören. Vor allem in
unserer westlichen Kultur gibt es weniger Eingebundenheit in der Gemeinschaft.
Dieser Mangel an Wurzeln oder Zugehörigkeitsgefühl ist abträglich für das
Identitätsgefühl.
Im Anschluss daran verweist Barrett-Lennard auf die Ressourcen von
Psychotherapie für die Heilung der Beziehungsfähigkeit auf allen diesen
Ebenen. Dabei muss jedoch die ganze Spannbreite von menschlichem Engagement berücksichtigt
werden: es geht um die Heilung der Beziehungen (der Sub-Selbste) innerhalb des
Selbst, um die Heilung der intimen und der funktionalen persönlichen
Beziehungen, der Zugehörigkeit zu Organisationen und zu gesellschaftlichen
sowie kulturellen oder religiösen Gemeinschaften sowie um die Heilung der
Verbundenheit mit der Natur und dem Kosmos. Zum Abschluss wird die Frage
aufgeworfen, ob unsere heutige Kultur zwangsläufig Entfremdung und Einsamkeit
verstärken muss. Neben der übermächtigen Tendenz einer isolierenden und
einseitig technologisch-ökonomischen Globalisierung sieht Barrett-Lennard auch
gewisse Tendenzen einer sich positiv entwickelnden Zivilisation.
Wolfgang
W. Keil
Ausbildung in Klientenzentrierter Psychotherapie der ÖGWG in der Ukraine
1994-1999 65
Der
Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) hat in den Jahren
1994 - 1999 ein großangelegtes Psychotherapie-Ausbildungsprojekt in der Ukraine
durchgeführt, an welchem die ÖGwG intensiv mitgearbeitet hat. Es ging dabei
darum, vielen im psychosozialen Feld in Osteuropa tätigen Kolleginnen und
Kollegen eine umfassende Möglichkeit zu bieten, bestimmte im westlichen Europa
vertretene psychotherapeutische Richtungen - darunter auch die
Klientenzentrierte Psychotherapie -
in einer authentischen Weise kennen zu lernen und sich darin auszubilden.
Im folgenden Artikel werden die Entstehung des Gesamtprojekts, der Kontext der
psychotherapeutischen Situation in der Ukraine, der Verlauf des Projekts, sowie
vor allem die Planung und Durchführung des von der ÖGwG betreuten Teils der
Ausbildung in Klientenzentrierter Psychotherapie dargestellt.
Rezensionen
Sylvia
Gaul
Godfrey
T. Barrett-Lennard, Carl Rogers' Helping System. Journey & Substance
74
Jobst
Finke
Dietrich
H. Moshagen (Hrsg.), Klientenzentrierte Therapie bei Depression, Schizophrenie
und psychosomatischen Störungen 77

 2|2001
Klicken
Sie hier für das Cover
2|2001
Klicken
Sie hier für das Cover
•
100 Jahre Carl Rogers
Gerhard
Stumm / Jochen Sauer
Editorial
3
Frank Margulies
Chéres collègues et chers collègues de la Suisse
romande
 5
5
Gerhard
Stumm
Carl
Ransom Rogers 7
Fachbeiträge
Hans-Peter
Ratzinger und Elisabeth Zinschitz
Innenansichten
– Außenansichten
Carl Rogers im Licht biografischer Texte
9
Dieser
Artikel gibt anlässlich des 100jährigen
Geburtstages von Carl Rogers eine Übersicht über
dessen Leben sowie eine Zusammenschau der
existierenden biografischen Schriften. Beschrieben
wird Carl Rogers anhand autobiografischer Texte
sowie aus der von persönlichen Erfahrungen geprägten
Sicht seiner Kinder. Ergänzt wird dies durch die
biografischen Arbeiten von Howard Kirschenbaum,
Brian Thorne, David Cohen und Norbert Groddeck,
die ihre Darstellungen von Rogers’
Lebengeschichte mit der Entwicklung der Theorie
des Personzentrierten Ansatzes verknüpfen. Die
vorliegende Darstellung geht auf die
unterschiedlichen Schwerpunkte, die in diesen drei
Annäherungen gesetzt werden, ein.
Zur
Aktualität von Carl Rogers aus heutiger Sicht
Zwölf
Perspektiven
20
Ein
Kernstück dieses Schwerpunktheftes zu Carl Rogers
stellen Kommentare von renommierten Repräsentanten
des Personzentrierten Ansatzes aus sechs Ländern
zu wesentlichen Arbeitsbereichen und zentralen
Aspekten seines breiten Schaffens dar - erweitert
um ein kurzes Statement von Tom Greening, immerhin
Herausgeber des „Journal of Humanistic
Psychology“. Den Anfang macht Natalie Rogers,
Carls’ Tochter, die mit ihm vor allem in der
Encounterperiode zusammen gearbeitet und in
weiterer Folge ihre „Expressive Arts Therapy“
entwickelt hat, dabei auf die von ihm formulierte
Theorie der Kreativität zurückgreifend. Jürgen
Kriz, Jochen Eckert und David Cain befassen sich
in ihren Beiträgen jeweils mit Rogers als
Wissenschafter und Psychotherapieforscher bzw.
auch mit Forschungsergebnissen, wie die
Klientenzentrierte Psychotherapie in der Praxis
abschneidet.
Hans Swildens würdigt in seinem Artikel
einerseits die praktischen Verdienste von Rogers,
relativiert zugleich aber dezidiert und kritisch
die von Rogers vertretene humanistische
Grundposition und seine gesellschaftspolitischen
Exkurse. Die Therapietheorie ist bei Finke und
Greening angesprochen: Während ersterer die
Grundprinzipien des Anerkennens, Verstehens und
Begegnens herausarbeitet, verblüfft unser
amerikanischer Kollege mit der provokanten These,
dass Rogers direktiv am inneren Bezugsrahmen der
Klienten interessiert war.
Entwicklungstheoretischen Fragestellungen, ein
Aspekt, den Rogers nur am Rande streifte, gehen
Eva-Maria Biermann-Ratjen und Diether Höger nach:
In ihren Stellungnahmen zeigen sie auf, wie sehr
die personzentrierte Theorienbildung in diesem
Bereich sich doch mit modernen Konzepten aus der Säuglingsforschung
und Bindungstheorie verträgt. Schließlich widmen
sich drei Statements gesellschaftlichen
Fragestellungen wie der Friedensarbeit, die
Michael Gutberlet in den Blick nimmt, der Bildung
durch Gruppenarbeit, wie sie von Maureen O’Hara
und John Wood, langjährigen Kollegen in der
Encounter-Gruppenarbeit, propagiert wird, und der
feministischen Perspektive. In den beiden
erstgenannten Gebieten war Rogers hochaktiv, für
die Frauenfrage war er sensibilisiert. Dass sich
hier selbst für einen solch feinfühligen Mann
wie Carl Rogers Grenzen auftaten, wird in Irene
Fairhursts Ausführungen deutlich.
Natalie
Rogers
Carls Rogers’
Theorie der Kreativität ins Leben umsetzen
21
Jürgen
Kriz
Rogers’
Verhältnis zur Wissenschaft
23
Jochen
Eckert
Zur Entwicklung der klientenzentrierten
Psychotherapieforschung 27
David
J. Cain
„Die
Fakten sind freundlich“
Belege aus der Forschung
für die Effizienz der
Klientenzentrierten und Experienziellen
Psychotherapien
29
Hans
Swildens
Carl Rogers – Übernahme der Erbschaft, ohne
Idealisierung 32
Jobst
Finke
Die Therapietheorie der Personzentrierten
Psychotherapie 34
Tom
Greening
Carl
Rogers als “direktiver” Psychotherapeut
37
Eva-Maria
Biermann-Ratjen
Zur Entwicklungspsychologie von Rogers
38
Diether Höger
Rogers und die Bindungstheorie 42
Michael
Gutberlet
Friedensarbeit
im Sinne von Carl Rogers beginnt in der Person.
Jetzt! 45
Irene
Fairhurst
Das
Werk von Carl Rogers aus einer feministischen
Perspektive 48
Maureen
O’Hara und John K. Wood
Das Bewusstsein von morgen kultivieren: Der
personzentrierte Prozess als transformierende
Schulung 51
Barbara
Reisel
The
clinical treatment of the problem child
Carl Rogers als Kinderpsychotherapeut
55
Der Artikel ist die
erstmalige - und zudem kommentierte -
Übersetzung eines Teiles der 1939
erschienenen Publikation von Carl Rogers „The
Clinical Treatment of the Problem Child“. Rogers
bezieht sich in diesem Buch auf sein Erleben und
seine langjährige Erfahrung als Kinder- und
Familientherapeut und zeigt sich auf der Suche
nach Konzepten, die dieser Erfahrung entsprechen.
Dabei streicht er die Bedeutung der emotionalen
Beziehung zwischen Kind und Therapeut hervor und
formuliert Ziele und Haltungen für die
therapeutische Arbeit, die als Geburtsstunde des
Personzentrierten Ansatzes angesehen werden können.
Alle grundlegenden
Kennzeichen und Ansätze, die eine
personzentrierte Therapie- und Persönlichkeitsentwicklungstheorie
ausmachen, sind bereits in diesem frühen Werk von
Rogers enthalten. Die Lektüre dieses Buches
bietet noch immer aktuelle Standpunkte in Bezug auf die Rahmenbedingungen therapeutischer
Arbeit im Familienkontext und macht die
Notwendigkeit deutlich, die reale Lebenssituation,
die Ressourcen der Familie und der unmittelbaren
Umgebung des Kindes in die Therapieplanung
miteinzubeziehen. Rogers war damit bereits 1939 in
vielen Überlegungen seiner Zeit voraus.
Christian
Korunka, Nora Nemeskeri und Joachim Sauer
Carl Rogers als
Psychotherapieforscher
Eine kritische Würdigung 68
Carl Rogers war nicht
nur der Begründer der Personzentrierten
Psychotherapie, er gilt auch als der Begründer
der empirischen Psychotherapieforschung. Seit den
frühen 1940er Jahren wurden über einen Zeitraum
von mehr als 20 Jahren von Rogers und seinen
Mitarbeitern zahlreiche Arbeiten zur
Psychotherapieforschung veröffentlicht, die bis
heute hohe Bedeutung besitzen. Dieser Beitrag
setzt sich das Ziel einer kritischen Würdigung
von Carl Rogers als Therapieforscher. Dabei werden
die drei wichtigsten Phasen der Forschung von Carl
Rogers genauer dargestellt und aus heutiger Sicht
bewertet. Die frühe, qualitative Forschungsphase
in den 1940er Jahren wird anhand der
„Parallelstudien“ vorgestellt. Exemplarisch für
die empirische Forschungsphase in Chicago werden
die Arbeiten im Sammelband von Rogers und Dymond
präsentiert. Als wichtigste Forschungsarbeit der
späteren Phase wird die „Wisconsin-Studie“
kritisch gewürdigt. Insgesamt ist festzuhalten,
dass die Arbeiten zur Psychotherapieforschung von
Carl Rogers bis heute in vieler Hinsicht als
vorbildlich und paradigmatisch betrachtet werden können.
Wolfgang
W.Keil
Das
für Psychotherapie notwendige Erleben
Oder: Personzentrierter und experienzieller Ansatz
gehören zusammen
90
Ausgehend
von der Betrachtung der für Psychotherapie nötigen
Art und Tiefe des inneren Erlebens wird in diesem
Artikel die wesentliche Zusammengehörigkeit des
Personzentrierten und des Experienziellen Ansatzes
erörtert. In einer ersten Annäherung wird ein
tiefes und empathisches Sich-Einlassen auf das
eigene innere Erleben als unabdingbar für einen
psychotherapeutischen Prozess beschrieben. Gendlin
hat dies prägnant mit den Begriffen des implizit
wirksamen Experiencing bzw. des Felt Sense
beschrieben. Es wird dargestellt, dass Rogers
Gendlins Experiencingkonzept voll übernommen hat,
dass er jedoch in seinem Therapiekonzept das
Hauptaugenmerk auf das Erleben der Therapeutin
richtet. Gendlin vertritt die gleiche Auffassung,
legt jedoch den Akzent darauf, dass durch die
therapeutische Kommunikation das Experiencing des
Klienten wirklich berührt werden muss. Diese
Akzentverschiebung wird bisweilen bis zur
Unvereinbarkeit von Personzentrierter und
Experienzieller Psychotherapie vergrößert. Als
Beispiele dafür werden die Erwägungen von
Brodley, Prouty und Schmid kurz referiert. Diesen
wird entgegen gehalten, dass es psychologisch
gesehen unmöglich ist, einen Widerspruch zwischen
der Person und ihrem Erleben zu konstruieren und
dass Psychotherapie nicht eindimensional bzw.
dichotomisierend als nur "technizistisch"
und "direktiv" oder ausschließlich als
volle personale Begegnung verstanden werden darf,
sondern immer eine volle Integration dieser
Gegenpole erreicht werden muss, wenn es sich um
Psychotherapie handeln soll.
Anna
Auckenthaler
Die Gesprächspsychotherapie vor dem Hintergrund
aktueller Entwicklungen in Klinischer Psychologie
und Psychotherapie 98
Der
zunehmenden Ausgrenzung der Gesprächspsychotherapie
aus den Lehrbüchern zur Klinischen Psychologie
und Psychotherapie wird die implizite Anerkennung
gesprächspsychotherapeutischer Annahmen und
Prinzipien im gegenwärtigen Psychotherapieverständnis
gegenübergestellt.
Glosse
Peter
F. Schmid
Herausforderungen.
Neun Vignetten zum Stand eines Syntagmenwechsels
103
Die
Auswirkungen des Syntagmenwechsels, die durch das
Werk von Carl Rogers in die Psychotherapie und darüber
hinaus in die verschiedensten Bereiche
zwischenmenschlichen Zusammenlebens gekommen sind,
lassen sich auch hundert Jahre nach seinem
Geburtstag noch nicht zur Gänze absehen. Sein
Erbe ist bei weitem nicht ausgelotet: Auch wenn
die Auswirkungen seiner reichen Arbeit oft nicht
mehr mit seiner Person verbunden werden, sein
Ansatz ist allenthalben zu finden. Allerdings wird
dem emanzipatorischen Konzept — kränkend und
bedrohlich für Autoritäten und Experten
verschiedenster Art — nachhaltig Widerstand
geleistet, der sich unter anderem von außen in
Ignoranz und Verharmlosung, von innen in Verwässerung,
Eklektizismus und Methodenvermischung zeigt. Der
Autoritätsgläubigkeit und dem Kontrollbedürfnis
setzt der Ansatz die humanistischen Vorstellungen
von Vertrauen und Selbstkontrolle entgegen, was
ihn auch politisch “gefährlich” macht. In
dieser Glosse werden einige der Herausforderungen
skizziert, die vom Ansatz ausgehen und vor denen
der Ansatz selbst steht.
Interviews
und Roundtable-Gespräch
Karin
Hegar, Margret Katsivelaris, Martina Kucera, Frank
Margulies,
Michael Rehrl, Michael Schwarz,
Maria Theurer und Harald Erik Tichy
Zur
Aktualität des Rogersansatzes in der heutigen
Psychotherapie-Ausbildung
Statements
von Ausbildungsteilnehmer/innen aus der APG, ÖGwG
und SGGT
109
Profil
zeigen - zum Hundertsten ein Institut. Interview
zur Eröffnung des PCA-Instituts in Zürich
geführt von Kathrin
Roth-Staudacher mit Bettina Bacher
118
Rezensionen
Margarethe
Letzel
Frenzel P., Keil W.W., Schmid P.F., Stölzl N.
(Hg.), Klienten-/ Personzentrierte Psychotherapie.
Kontexte, Konzepte, Konkretisierungen 120

 1|2002
Klicken
Sie hier für das Cover
1|2002
Klicken
Sie hier für das Cover
Gerhard Stumm /
Christian Korunka /
Elisabeth Zinschitz
Editorial
3
Fachbeiträge
Howard Kirschenbaum
Carl Rogers’ Leben und Werk:
Eine Einschätzung zum 100. Jahrestag seines
Geburtstags 5
Dieser Artikel gibt einen Überblick
über das Leben und Werk von Amerikas
einflussreichstem Berater und Psychotherapeuten
Carl Rogers (1902–1987) und seinen zahlreichen
Beiträgen auf dem Gebiet der Beratung. Er
entwickelte den nicht-direktiven,
Klientenzentrierten bzw. Personzentrierten Ansatz
für Beratung und die helfende Beziehung. Er machte
den Begriff „Klient“ populär, war die erste
Person, die Beratungssitzungen auf Tonträger
aufzeichnete, verwischte die Grenzen zwischen
Beratung und Psychotherapie und führte mehr
Forschung zu Beratung und Psychotherapie durch,
als je zuvor gemacht worden war. Er war eine
Leitfigur in der humanistischen psychologischen
Bewegung. In seinen späteren Jahren wandte er den
Personzentrierten Ansatz an, um Konflikte zwischen
Gruppen sowie internationale Konflikte zu lösen.
Sein Einfluss ist sowohl ein geschichtlicher als
auch ein gegenwärtiger, da die Arbeit zum
Klientenzentrierten Ansatz weitergeht und die
aktuelle Forschung viele von Rogers’ früheren
Beiträgen validiert.
Peter F. Schmid
Die Person im Zentrum der
Therapie. Zu den Identitätskriterien
Personzentrierter Therapie und zur bleibenden
Herausforderung von Carl Rogers an die
Psychotherapie
16
Carl Rogers hat nachdrücklich die
Person ins Zentrum der Psychotherapie gestellt.
Damit steht der Mensch in seiner unaufgebbaren
Dialektik von Selbstbestimmung und
Beziehungsangewiesenheit im Mittelpunkt von
therapeutischer Wissenschaft, Forschung und
Praxis, und es gehört zum unaufgebbaren State of
the Art, Psychotherapie als Kunst der personalen
Begegnung zu verstehen. Mit seinem
Person–zentrierten Ansatz gab Rogers somit
entscheidende Impulse für die Entwicklung der
Psychotherapie insgesamt. Wenngleich sich
gegenwärtig ziel- und methodenorientierte
Richtungen aufgrund der Forderungen nach
Effizienzmaximierung und Erfolgsorientierung als
quotenträchtig erweisen, so greifen zunehmend auch
ganzheitliche Konzepte und ein
beziehungsorientiertes Verständnis in
verschiedenen Schulen Platz. Dies ist durchaus als
Einfluss des Personzentrierten Ansatzes zu sehen.
Dennoch bleiben diese Tendenzen, oft weit, hinter
dem radikalen Syntagmenwechsel von Rogers zurück.
Dasselbe gilt auch für Entwicklungen innerhalb des
Ansatzes, die ihn selbst verwässern oder
verharmlosen und für solche, die ihn vereinnahmen.
Rogers hat mit seinem Werk für die gesamte Zunft
einen reichen Auftrag hinterlassen – mit einem
Ansatz, dessen tiefer Humanismus und dessen
kritisches Potenzial innerhalb und außerhalb des
Personzentrierten Ansatzes bei weitem nicht
eingeholt ist.
Zudem hat sich Rogers wiederholt eine
Weiterentwicklung seiner Theorie gewünscht. Der
folgende Beitrag anlässlich des hundertsten
Geburtstages versteht sich in diesem Sinne und
unternimmt eine doppelte Standortbestimmung: Zum
einen nach außen hin als Anfrage an die
verschiedenen Schulen der Psychotherapie, wieweit
sie sich den Herausforderungen von Carl Rogers
stellen, und an den Ansatz selbst, wie weit er
sich als eine solche Herausforderung an die
Psychotherapie und Gesundheitspolitik der
Gegenwart versteht. Zum anderen nach innen hin, an
die „personzentrierte und experienzielle Familie“,
als Frage, wo wir stehen und wohin wir gehen,
somit als ein Beitrag zur Frage der Identität und
Zukunft. Angesichts der verwirrenden
Positionsvielfalt in der Psychotherapie im
Allgemeinen und deren personzentrierter
Ausrichtung im Besonderen wird die Frage nach den
Kriterien für eine Identitätsbestimmung gestellt.
Dieser Frage nach dem „Gesicht“ und damit der
Erkennbarkeit des Personzentrierten Ansatzes wird
sodann anhand von unterscheidenden Charakteristika
nachgegangen, die ihrerseits wieder als
identitätsstiftend verstanden werden. Aus einem am
Begründer orientierten Verständnis
personzentrierter Anthropologie, Erkenntnistheorie
und Ethik und den aktuellen gesellschaftlichen
Verhältnissen ergeben sich provokante
Anforderungen für weitere Entwicklungen in
Gesellschaft und Psychotherapie. Durch die Frage
nach den unterscheidenden Kriterien werden einige
dieser Herausforderungen für den Personzentrierten
Ansatz selbst wie für andere therapeutische
Orientierungen sichtbar.
Wolfgang W. Keil
Zur Erweiterung der
personzentrierten Therapietheorie
34
Um die klinischen Aspekte der
Personzentrierten Psychotherapie deutlicher
abzubilden, sollte deren Therapietheorie erweitert
werden, dies jedoch nicht im Sinn einer Ergänzung
durch andere Konzepte, sondern im Sinn einer
Explikation des implizit Enthaltenen. Eine erste
Erweiterung des Konzepts von Rogers kann in
Gendlins Experiencing-Theorie gesehen werden. Hier
wird die von den Grundeinstellungen des
Therapeuten auszulösende Art und Tiefe des inneren
Erlebens der Klientin, die für Psychotherapie
erforderlich ist, und die von Rogers nicht
ausformuliert wurde, voll ausgearbeitet.
Weitere klinische Aspekte werden explizit, wenn –
ausgehend von Rogers’ Persönlichkeitstheorie –
bedacht wird, dass und auf welche Weisen der
Psychotherapeut ermöglichen soll, dass
inkongruentes, abwehrendes oder leeres Erleben der
Klientin sich zu implizit wirksamem, authentischem
Erleben verändern kann. Der Therapeut muss hierbei
das Erleben der Klientin im Sinn einer
prozessualen Diagnostik wahrnehmen und dieses
allmählich mittels hermeneutischer Empathie aus
der lebensgeschichtlichen Bedeutung heraus
verstehen lernen. Darüber hinaus ist hier auch zu
denken an schwer zu verstehende Erlebensformen,
wie sie von frühen Störungen und
Entwicklungsstagnationen her bedingt sind (u. a.
„fragile processes“ nach Warner) sowie an „präsymbolische“
Erlebensformen (nach Prouty). Eine erweiterte
personzentrierte Therapietheorie sollte – und dazu
wird in diesem Beitrag ein Versuch unternommen –
demnach generell darlegen, wie der Therapeut
solches Erleben wahrnehmen kann (diagnostisches
Moment) und v. a. auf welchen Wegen die
Veränderung solchen Erlebens zu implizit wirksamem
Experiencing und kongruentem Erleben geschehen
kann (Änderungswissen). Darüber hinaus ist auch zu
umreißen, welche professionelle Kompetenz der
Therapeut aufzuweisen hat, um derartige
Veränderungen in der Praxis zu ermöglichen bzw. zu
fördern. Diese Kompetenz wird hier v. a. in der
Fähigkeit, eine intensive Arbeitsbeziehung
herzustellen, sowie in der Fähigkeit, auf vielen
verschiedenen Ebenen von Symbolisierung arbeiten
zu können, gesehen.
Margaret S. Warner
Psychologischer Kontakt,
bedeutungstragende Prozesse und die Natur des
Menschen.
Eine Neuformulierung personzentrierter Theorie
45
Margaret
Warner möchte in diesem Beitrag das personzentrierte Konzept vom menschlichen Kontakt
umfassend neu formulieren und dessen Bedeutung für
das gesamte Menschenbild des Ansatzes aufzeigen.
Zunächst würdigt sie Rogers’ minimale Definition
vom „psychologischen Kontakt“ sowie Proutys
Ausweitung und Verschiebung derselben. Dabei wird
der essenzielle Zusammenhang von psychologischem
Kontakt mit dem Verarbeiten („processing“) von
organismischer Erfahrung bzw. dem Definieren von
deren Bedeutung herausgearbeitet. Diese Prozesse
dürfen weder mechanistisch (wie
Ursache-Wirkungs-Sequenzen) noch so verstanden
werden, als ob dabei unterschwellig
prä-existierende („verdrängte“) Phänomene eine
Rolle spielten. Die Sichtweise, dass wir fähig
sind, innerhalb zwischenmenschlicher Interaktion
vielfältig disparate Erfahrungen integrativ in
ihrer Bedeutung zu erfassen und diese Bedeutungen
kreativ immer neu zu reorganisieren, wird gestützt
durch Hypothesen der Evolutionspsychologie (bereichsübergreifendes
Denken) und der Bindungstheorie (Lernen von
kulturell adäquatem Aushandeln von Bedeutung).
Dementsprechend definiert Warner Kontakt als
grundlegende Fähigkeit des Organismus, sich (zu
sich selbst wie mit anderen) bedeutungsvoll
gegenwärtig erleben zu können. Es wird ausführlich
dargelegt, welche Rolle dabei „weiche“ Bedeutungen
wie subjektive Motive, Selbst(bilder) usw. spielen
und wie aus diesen immer ein kohärenter und vielen
Zwecken zugleich dienender Bedeutungszusammenhang
(„multi-purpose narrative“) geschaffen werden
kann. Damit werden gleichzeitig viele Aspekte des
personzentrierten Verständnisses von der Natur
Menschen konkretisiert, geklärt und integriert.
Abschließend erörtert die Autorin ihr aus diesem
Ansatz entwickeltes einfühlsames Verständnis von
Personen mit Störungen im Verarbeiten von
Erfahrungen und im Kontakt („fragile process“, „dissociate
process“) und umreißt den personzentrierten
therapeutischen Umgang mit ihnen.
Bernd Heimerl und Inge Frohburg
Empathie in der
psychotherapeutischen Praxis
Eine empirische Untersuchung zur Frage ihrer
Dimensionalität
59
Empathie ist ein komplexes
Konstrukt, bei dem auf theoretischer Ebene häufig
zwischen kognitiven und emotionalen Anteilen
unterschieden wird. Das Ausmaß der individuellen
Realisierungsmöglichkeiten der genannten
Empathiekomponenten kann mit Hilfe eines
Empathie-Selbsteinschätzungsbogens von Davis
(1983) (deutsche Übersetzung von Kleiber et al.
1992) erfasst werden. Die Auswertung der
Fragebogendaten von 222 Psychotherapeuten ergab
unabhängig von der gewählten Psychotherapiemethode
ähnliche Ausprägungsgrade, eine hohe
Interkorrelation der dimensionsbezogenen Skalen
und Hinweise auf den Einfluss der Berufsdauer auf
die Empathie. Aus den Selbsteinschätzungen der
praktisch tätigen Psychotherapeuten lassen sich
damit die konzeptualisierten Dimensionen von
kognitiver und emotionaler Empathie nicht
bestätigen.
Gert-Walter Speierer
Qualitätskontrolle und
Prozessevaluation in der personzentrierten
Selbsterfahrungsgruppe
Empirische Ergebnisse
65
Gegenstand der Arbeit ist die
Frage, in welchem Ausmaß spezifische Ziele der
personzentrierten Selbsterfahrungsgruppe erreicht
werden. Dazu wurden 172 GruppenteilnehmerInnen von
16 Gruppen mit je 10–15 Personen vor Beginn und
nach dem Ende ihrer bis zu 40 Stunden dauernden
Gruppenerfahrung sowie nach jeder Gruppensitzung
mit empirisch validierten Fragebögen untersucht.
Hauptergebnisse sind: 81 %–97 % der
GruppenteilnehmerInnen erreichen die definierten
Ziele der Gruppenarbeit, i. e. therapeutische
Eigenerfahrungen, Erfahrung in eigenen hilfreichen
Interventionen und hilfreichen Interventionen
anderer GruppenteilnehmerInnen sowie persönliche
Beziehungserfahrungen. Dazu kommen ausgeprägte
spezifische Prozesserfahrungen, i. e.
Selbstöffnung, gegenseitiges Vertrauen sowie
Verständnis, Hilfe und Nähe des Facilitators bei
mehr als 84 % der TeilnehmerInnen. Es wird
gezeigt, wie die Ergebnisse der Gesamtgruppe als
Benchmark zur Beurteilung des Erfolges einzelner
Gruppen und einzelner Personen verwendet werden
können.
Angelo Lottaz
Das Unaussprechliche zu Wort
bringen
Gedanken zur Psychotherapie mit Opfern der Folter
77
Es wird ein personzentrierter
Zugang zu gefolterten Menschen beschrieben.
Zentral ist dabei das Verständnis für den
gesellschaftlichen Charakter der erlittenen
„fundamentalen Inkongruenz zur Welt“. Um
angemessen mit der Thematik des Bösen, des
Dunklen, des nicht therapierbaren Leidens umgehen
zu können, ist ein gutes Arbeitsteam nötig. Da das
Erleben von Gefolterten geprägt ist vom Gefühl der
Fremdheit der Welt und sich selber gegenüber, ist
es besonders schwierig, aber um so wichtiger,
behutsam und unbeirrt danach zu suchen, in
Beziehung zu ihnen zu kommen.
André de Peretti
Die
Globalisierung, der Personzentrierte Ansatz und
die Kultur des Barock
88
In diesem Beitrag erörtert der
Autor seine Hypothese, dass die moderne Welt durch
die Umwälzungen der Globalisation in ein Zeitalter
geschleudert wird, das mit dem Barock vergleichbar
ist. Diese Periode zeichnete sich durch Üppigkeit,
„Trug“ und „Täuschung“ aus, aber auch durch eine
optimistische Haltung, die gleichzeitig das
Negative nicht ausschloss, also ein Zeitalter der
Paradoxa. Der Autor meint, dass der
Personzentrierte Ansatz sehr gut dazu passt, da er
dem Prinzip des Paradoxons folgt: Der
Personzentrierte Therapeut vertritt eine positive
Haltung, indem er ganz in seiner Kongruenz und
Akzeptanz präsent ist, und bekennt sich
gleichzeitig zur Negativität als Verneinung, indem
er eine gewisse Zurückhaltung übt, um eine
Abhängigkeit des Klienten zu vermeiden. Er
arbeitet mit dem metaphorischen Kolibri auf der
Schulter.
Rezension
Jürgen Kriz
Keil, W.W / Stumm, G. (Hg.):
Die vielen Gesichter der Personzentrierten
Psychotherapie 95

 2|2002
2|2002
Christian Korunka /
Gerhard Stumm
Editorial
3
Fachbeiträge
Robert Kramer
„Ich wurde von Rank’schem
Gedankengut angesteckt“
Die Wiener Wurzeln des Personzentrierten Ansatzes 5-18
Carl Rogers ist einer der wichtigsten Figuren in
der humanistischen Psychologie auf der ganzen
Welt. Umso erstaunlicher ist es, dass fast niemand
die ganze Geschichte kennt, wie er dazu kam, die
personzentrierte Therapie zu entwickeln. Rogers
hat immer anerkannt, dass eine persönliche
Begegnung mit dem Wiener Psychologen Otto Rank
1936 seine Denkweise über Psychotherapie
grundlegend veränderte, als er noch ein relativ
unbekannter Counselor in Rochester, NY, war. „Ich
wurde von Rank’schem Gedankengut angesteckt“,
sagte Rogers über seine Begegnung mit Rank, der
damals bereits ein weltberühmter Psychologe war.
Diese Begegnung veränderte sein Leben. Mitte der
zwanziger Jahre, nachdem er zwei Jahrzehnte an
Freuds rechter Seite verbracht hatte, brach Rank
mit der klassischen Psychoanalyse, da Freud die
prä-ödipale Theorie und die experienzielle „Hier-und-Jetzt“-Therapie,
für die Rank zusammen mit Sándor Ferenczi
Pionierarbeit leistete, nicht akzeptieren konnte.
Rank kritisierte Freud auch, da er die Kreativität
zu einer bloßen Unbeständigkeit des Sexualtriebes
reduzierte und nicht erkannte, was Rank
den „kreativen Willen“ nannte. Das Ergebnis
war, sagte Rank, „dass das wirkliche Ich oder
Selbst mit seiner eigenen Kraft, nämlich dem
Willen“ aus der Freud’schen Therapie „ausgeblendet
wird“. Dieser Artikel erzählt die relativ
unbekannte Geschichte von Otto Ranks Einfluss auf
Carl Rogers.
Marion N. Hendricks Gendlin
Ein Felt Sense ist mehr als nur ein Gefühl 19-25
Für Therapeuten in der Arbeit mit Klienten ist es
wichtig, klar zwischen Felt Sense und Gefühl zu
unterscheiden. Diese Unterscheidungsfähigkeit soll
in der Ausbildung erlernt werden. So wichtig es
auch sein mag, ein Gefühl wahrzunehmen, so
verändert doch diese Wahrnehmung nicht das Muster,
das zur Entstehung dieses Gefühls führt. Nur indem
der Klient dieses Gefühl „anhält“, kann er mittels
seines Felt Sense die Bedeutung verstehen lernen
und auch was verändern.
Jobst Finke
Das Menschenbild des
Personzentrierten Ansatzes zwischen Humanismus und
Naturalismus 26-34
Angesichts der in Natur- und Humanwissenschaften
aktuellen Naturalismus-Kulturalismus-Kontroverse
hat sich die Personzentrierte Psychotherapie zu
positionieren und für sich zu klären, ob sie in
ihren fundamentalen Begründungen stark
humanistischen oder eher
biologistisch-physikalistischen
Argumentationslinien folgt. Da sich aus den
Entwürfen der Humanistischen Psychologie
personalistisch und subjekttheoretisch begründete
Positionen ergeben, Positionen, die konträr zu
naturalistischen Ansätzen stehen, werden
diesbezügliche Selbstdefinitionen des PCA
untersucht. Besonders am für die
Persönlichkeitstheorie des PCA zentralen Konzept
der Aktualisierungstendenz und des „Wachstums“
sowie etwa der diesbezüglichen Bezugnahmen auf
moderne Autopoiesismodelle wird die gelegentlich
doppeldeutige, oft eindeutig naturalistische
Argumentationsweise innerhalb des PCA gezeigt.
Dabei werden auch die Konzepte von „Natur“ (der
Natur im Allgemeinen, der menschlichen im
Besonderen) in ihren oft sehr differenten
Erscheinungsweisen beschrieben. Es wird für ein
dezidiert humanistisches, d.h. personalistisch,
subjekttheoretisch wie kulturhistorisch
begründetes Menschenbild des PCA plädiert.
Schließlich soll das Konzept der
Aktualisierungstendenz unter einer eher
anwendungsorientierten, aber auch humanistischen
Perspektive konkretisiert werden. So wird
versucht, die „Aktualisierungstendenz“ in den
Äußerungsformen personalen Lebensvollzuges zu
fassen. Als solche Äußerungsformen werden das
Selbstkonzept, die Lebensthematik und die
Lebenstechnik herausgestellt.
Diether Höger / Doris Müller
Die Bindungstheorie als Grundlage für das
empathische Eingehen auf das Beziehungsangebot von
Patienten
35-44
In diesem Beitrag soll theoretisch begründet und
mit einem Fallbeispiel veranschaulicht werden, wie
anhand der von Bowlby und Ainsworth begründeten
Bindungstheorie das Beziehungsangebot der
Personzentrierten Psychotherapie und dessen
Wirksamkeit theoretisch begründet werden kann.
Darüber hinaus gibt sie auch für die Praxis
entscheidende Hinweise für die Gestaltung
therapeutischer Interventionen, die auch unter
schwierigen Bedingungen vom Patienten als zugleich
empathisch und bedingungsfrei akzeptierend
wahrgenommen werden können.
Elisabeth Zinschitz
Beziehung: Ein
tausendfach reflektierender Spiegelsaal
Kontakt und Wahrnehmung als beziehungsgestaltende
Elemente
45-54
Ziel dieses Artikels ist es, Überlegungen darüber
anzustellen, welche Grundfähigkeiten der Mensch
haben muss, um überhaupt von einer therapeutischen
Beziehung profitieren zu können. Die
personzentrierte Literatur beschäftigt sich in
erster Linie mit den vom Therapeuten zu
erfüllenden Bedingungen der Empathie, Akzeptanz
und Kongruenz. Hier jedoch liegt das Augenmerk auf
der ersten und sechsten Bedingung, die vom
Klienten erfüllt werden müssen und in denen es um
Kontaktfähigkeit und Wahrnehmung geht. Im
Folgenden wird zuerst die personzentrierte und
dann die entwicklungspsychologische Perspektive
herangezogen, um zu verstehen, welche Fähigkeiten
für diese beiden Funktionen erforderlich sind.
Abschließend wird noch überlegt, dass diese
Erkenntnisse für die psychotherapeutische Arbeit
mit geistig behinderten und psychotischen Klienten
von Interesse sein können.
Ludwig Teusch
Personzentrierte Angstforschung
Störungsbezogenes
Vorgehen und Ergebnisse 55-59
Die Entwicklung und Ergebnisse der Essener
Arbeitsgruppe Gesprächspsychotherapie-Forschung
zur Behandlung von Panik und Agoraphobie werden
vorgestellt. In Anlehnung an das Phasenmodell von
Swildens wurde ein manualgeleitetes
therapeutisches Vorgehen entwickelt. In Therapie-
und Verlaufsstudien wurde nachgewiesen, dass die
Gesprächspsychotherapie effektiv die
Leitsymptomatik Panik und Agoraphobie und die den
Angststörungen zugrunde liegenden
Persönlichkeitsdefizite vermindert.
Therapietheoretisch hervorzuheben ist, dass
nachgewiesen werden konnte, dass die
Gesprächspsychotherapie über eigene
Wirkmechanismen zur Angstreduktion führt.
Verglichen mit einer Kombination aus
Gesprächspsychotherapie und
verhaltenstherapeutischer Reizkonfrontation
reduziert ausschließliche Gesprächspsychotherapie
besonders nachhaltig die übergroße
Hilfsbereitschaft, die körperliche Affektresonanz
und die subjektive Stressbelastung. Im Anschluss
an die Gesprächspsychotherapie nehmen die
Therapieeffekte noch weiter zu. Diese
„Nachbesserung“ im Katamnesezeitraum weist auf die
„aktualisierenden Tendenz“ hin.
Michael Behr / Nicole Doubek / Steffi Höfer
Authentizität als Einheit
Authentizität als Einheit von Erfahrung,
Selbstkonzept und Echt-Sein am Beispiel von
unterrichtenden Lehrern 60-70
Die klientenzentrierte Theorie beschreibt
Authentizität als Einheit von Erfahrung,
Selbstkonzept und Echt-Sein mit anderen. Drei
Studien prüfen, ob es nützlich ist, Authentizität
in zwei Konzepte zu unterteilen: intrapersonale
Authentizität als Kongruenz von Erfahrung und
Selbst, und interpersonale Authentizität als
Echt-Sein mit anderen. In drei Studien werden je
30 bis 35 unterrichtende Lehrer auf ihr Echt-Sein
geratet. Selbstkonzept-Maße der Lehrer zeigen
niedrige Korrelationen zwischen intra- und
interpersonaler Authentizität. Erleben von
entweder zu wenig oder von überflutenden Emotionen
prädiziert unterschiedliche Muster bei den
Selbstkonzept-Maßen. Drei Subskalen für Echt-Sein
in der Schule besitzen gute
Inter-Rater-Reliabilität und Validität. Sie können
bei pädagogischen Ausbildungen und in der
Forschung eingesetzt werden.
Bericht
Jobst Finke
Der Kampf um Anerkennung
Die Geschichte der öffentlich-rechtlichen
Etablierung der Gesprächspsychotherapie in
Deutschland 71f
Rezensionen
Hermann Spielhofer
Iseli, C. / Keil, W. W. / Korbei, L. / Nemeskeri,
N. / Rasch-Owald, S. / Schmid, P. F. / Wacker, P.
G. (Hg.), Person-/Klientenzentrierte
Psychotherapie und Beratung an der
Jahrhundertwende
73-77
Wolfgang W. Keil
Ryback, D., Emotionale
Intelligenz im Management. Wege zu einer neuen
Führungsqualität &
Terjung B. / Kempf T., Von der Klientenzentrierten
Therapie zur Personzentrierten
Organisationsentwicklung
(Person-Centered Organization-Development – PCOD)
78f

 1|2003
1|2003
•
Schwerpunkt: Der Personzentrierte Ansatz im
Spannungsfeld zwischen
wissenschaftlicher Theorie und gelebter Praxis
Klicken
Sie hier für das Cover und die inneren
Umschlagseiten (Impressum & Register)
Ulrike Diethardt
/ Margarethe Letzel
Der
Personzentrierte Ansatz im Spannungsfeld zwischen
wissenschaftlicher Theorie und gelebter Praxis
Editorial
3
Brigitte Macke-Bruck
Die Erfahrungswelt in der
beruflichen Praxis
Theorie und Praxis aus der Sicht einer
Praktikerin
3-14
Die berufliche Erfahrungswelt einer
personzentrierten Praktikerin zeichnet sich
durch ihre jeweilige Einzigartigkeit aus und ist
in einem ständigen Prozess von Weiterentwicklung
befindlich. Aus der Perspektive der
psychotherapeutischen Praxis werden die eigenen
Beziehungen zur Theorie, zur beruflichen Praxis
und zur Wissenschaft als Umgebung von Praxis
untersucht. Dabei werden Bezüge zur Professions-
bzw. Aktionsforschung hergestellt. Zuletzt wird
die in der Praxis entstandene „Forschungskultur“
als eine der Quellen beruflicher Entwicklung
beschrieben: Im Rahmen eines personzentrierten
Zugangs wird die, in der Weiterentwicklung des
Selbstkonzepts enthaltene Empathieentwicklung
einer Therapeutin gefördert.
Michael
Gutberlet
Die personzentrierte Haltung: die Kraft, die
Veränderung schafft?
Über die Schwierigkeiten des Verstehens und
Vermittelns von Rogers’ sanfter Revolution
15-23
In Ausbildungen und
Fachdiskussionen wird nach wie vor die für die
Praxis sehr bedeutsame Frage gestellt, ob die
personzentrierte Haltung, wie sie Rogers
formuliert und erforscht hat, für konstruktive
Persönlichkeitsveränderung als hinreichend gilt,
oder ob eine Erweiterung des Ansatzes notwendig
ist.
Der Autor stellt dazu folgende Positionen zur
Diskussion:
- Rogers’ Haltungskonzeption stösst auf Skepsis
und Unverständnis, weil sie im Widerspruch steht
zum gängigen Wissenschafts- und
Bildungsverständnis und auch eine sehr
ungewohnte, erfahrungsbezogene Vermittlungsform
erfordert, ohne die sie nicht wirklich
verstanden werden kann.
- Rogers’ Haltungskonzeption stösst auf Skepsis
und Unverständnis, weil sie im Widerspruch steht
zum gängigen Wissenschafts- und
Bildungsverständnis und auch eine sehr
ungewohnte, erfahrungsbezogene Vermittlungsform
erfordert, ohne die sie nicht wirklich
verstanden werden kann.
Die personzentrierte Haltung als eine Erfahrung
ist das entscheidende und hinreichende Agens für
Veränderung und Heilung.
- Personzentrierte Haltung und der punktuellen
Gebrauch von ausgearbeiteten Techniken, von
lenkendem oder führendem Therapeutenverhalten
schliessen einander nicht aus, sofern erstens
gewährleistet ist, dass der innere Bezugsrahmen
der Person – und nicht Theorie oder Technik -
unangefochten im Zentrum der Aufmerksamkeit von
TherapeutInnen steht und zweitens KlientInnen
über jeden ihrer Schritte selbst entscheiden
können. Diese Auffassung wird begründet, ihre
Umsetzung in der Praxis verdeutlicht und auf
ihre Risiken hingewiesen.
Christian Fehringer
Eine essayistische
Beschreibung von Supervisionsprozessen
24-28
Supervision
stellt ein Lernphänomen dar, das sich darauf
bezieht, wie man etwas über einen bestimmten
Lernkontext lernt. Bezogen auf die Supervision
bedeutet es, dass der Gegenstand des Lernens die
Art der Interpunktion von Erzählungen, von
Ereignissen ist. Supervisanden sollten sich
diese Art des Lernens ermöglichen um mit einer
Vielzahl von Perspektiven in ihren
therapeutischen Beziehungen arbeiten zu
können. Die Absicht in Supervisionsprozessen
liegt nicht darin, Supervisanden zu verändern.
Das Anliegen ist darin zu sehen, den
Supervisanden behilflich zu sein, neue
Beschreibungsmöglichkeiten für hochkomplexe und
somit oft unentscheidbare therapeutische /
beraterische Konstellationen zu (er)finden. Im
Personzentrierten Ansatz wird dieses
Arbeitsverständnis mit dem Begriff „to
facilitate“ bezeichnet. Dieser Prozess soll in
der vorliegenden Arbeit beschrieben und
konkretisiert werden.
Franz
Berger
Veränderungsepisoden und Bedeutungskonstruktion
im Personzentrierten Therapieprozess
29-36
Woran
erkennt der Praktiker während eines
Therapieverlaufs unter den vielfältigen
Phänomenen jene Veränderungen, die für den
Therapieverlauf bedeutsam sind? Letztere sind
für den Autor keine objektiven Gegebenheiten,
sondern komplexe Konstruktionen in Form von
Erzählungen und Wahrnehmungskonfigurationen.
Orientierungsraster für
Veränderungswahrnehmungen und ‑schlussfolgerungen
leitet der Autor aus der personzentrierten
Therapietheorie ab, er bezieht sich dabei auf
Prozess‑ und Therapieziele. Als Indikatoren
gelten etwa so konkrete Phänomene wie die
Zunahme der Selbstexploration und die Vertiefung
des Experiencing, aber auch weit abstraktere wie
zum Beispiel die Reduktion der Inkongruenz oder
die Veränderung des Selbstkonzepts. In den
einzelnen Therapiephasen sind
Veränderungssignale unterschiedlich bedeutsam.
Veränderungen im Therapieprozess werden als
Muster manifest. Illustriert werden diese anhand
einer Reihe von änderungsbezogenen
Therapieausschnitten aus dem Kontext der
Studierendenberatung.
Sylvia Keil
„Wenn ich mich so wie ich
bin akzeptiere, dann ändere ich mich.“
Methodische Implikationen Klientenzentrierter
Psychotherapie
37-50
In diesem
Artikel werden Bedingungen für persönliche
Veränderung durch Klientenzentrierte
Psychotherapie aus der Perspektive der Praxis
behandelt. Folgende Fragen stehen im Zentrum der
Darstellung: Woran erkennen Psychotherapeutinnen
therapeutisch relevante Veränderung und welche
Methoden und Techniken stehen ihnen zur
Verfügung, um Veränderung zu ermöglichen?
Zunächst werden allgemeine methodische
Prinzipien im Mikro- und Makroprozess der
Psychotherapie beschrieben. Dazu zählen die
kontinuierliche Symbolisierung der impliziten
Therapieziele, die Beachtung der jeweiligen
Phase der Therapie und erlebensfördernde
Interventionen im therapeutischen Dialog.
Als zentrales Agens der Psychotherapie wird die
prozessuale Reflexion der therapeutischen
Beziehung betrachtet. Das Veränderungspotenzial
liegt gerade in der Bewältigung der Abweichung
der tatsächlichen therapeutischen Beziehung von
der in der Therapietheorie geforderten
Beziehungsqualität. Die auf Grund dieser
Abweichungen notwendige Veränderung der
Therapeutin selbst in der therapeutischen
Beziehung ist ein Motor und gleichzeitig ein
Indikator für strukturelle Veränderungen der
Klientinnen. Parallel dazu entstehen
Verstehenshypothesen, die kontinuierlich
gemeinsam mit der Klientin überprüft und
modifiziert werden. Diese enthalten gerade durch
den akzeptierenden Charakter einen bedeutsamen
Veränderungsimpuls. Die Fähigkeit,
Verstehenshypothesen zu entwickeln, gehört zu
den wesentlichen methodischen Kompetenzen einer
klientenzentrierten Psychotherapeutin.
Klaus
Heinerth
Woran erkenne ich, dass
Veränderung beim Klienten geschieht?
51-56
Es werden aus der Praxis des
Autors als Gesprächspsychotherapeut und
Supervisor sowie aus der wissenschaftlichen
Beschäftigung mit dem klientenzentrierten
Konzept einige Fragen gestellt, sehr persönlich
betrachtet und einzelne Antworten versucht,
vorläufig und unsystematisch: Woran erkenne ich,
dass Veränderung beim Klienten geschieht?
(quantitative Veränderungen, qualitative
Veränderungen, Pseudoveränderungen)? Woran
erkenne ich, dass kein Wachstum stattfindet? Was
mache ich, wenn ich den Eindruck habe, es
geschieht keine Veränderung? Wie verändere ich
mich als Therapeut durch die Therapie?
Rosina Brossi
Unzeitgemäss?
Gedanken einer Praktikerin zum
Thema Langzeittherapien
57-65
Entlang den
Äusserungen von Klientinnen und Klienten wird
die Erfahrung mit Prozessen in Langzeittherapien
nachgezeichnet. Die Klientinnen und Klienten
machen deutlich, dass sie für den Aufbau der
therapeutischen Beziehung und speziell für die
Phasen von Stagnationen im Wachstumsprozess viel
Zeit und eine verlässliche, nicht wertende
Anwesenheit der Therapeutin brauchen.
Beschrieben wird auch, was die "Langsamkeit"
dieser Prozesse jeweils für das Erleben und
Verhalten der Therapeutin - das heisst für die
Konkretisierung des Beziehungsangebotes -
bedeutet. Die Prozessschritte, die im Laufe des
Artikels sichtbar werden, zeigen, wie die in der
Veränderungstheorie beschriebenen Prozesse bei
Menschen stattfinden können, die an einer
schweren psychischen Störungen leiden.
Corinne Rickenbacher-Fromer
Die Ingredienzen des therapeutischen Prozesses
66-69
Der Artikel
versucht die wichtigsten Elemente des
therapeutischen Prozesses zu erfassen. Er
thematisiert auch die Komplexität und die
Schwierigkeiten dieses Prozesses. Wichtig ist
das mitmenschliche Engagement der Therapeutin
sowie die Bereitschaft der Klientin, sich auf
das Beziehungsangebot der Therapeutin
einzulassen. Der therapeutische Prozess
ermöglicht durch das Engagement der Therapeutin
emotionale Beziehungskorrekturen. Es ist
wichtig, der Klientin die Werkzeuge auf den Weg
zu geben, die ihr helfen, sich zu aktualisieren.
Die Therapeutin muss also jede Therapie auf die
konkrete Klientin abstimmen. Dieser Prozess
verändert schliesslich die Therapeutin und die
Klientin.
Christian Korunka, Wolfgang W. Keil und Kristin
Haug-Eskevig
Klientenzentrierte Psychotherapie in Österreich
Eine Bestandsaufnahme aus praxeologischer Sicht
70-80
Die
vorliegende Studie setzte sich zum Ziel, die
Durchführung ambulanter Klientenzentrierter
Psychotherapie in Österreich aus einer
praxeologischen Perspektive zu beschreiben. Dazu
wurden Klientenzentrierte PsychotherapeutInnen
(Mitglieder der ÖGwG) u. a. gebeten, ihre
“letzten beiden ordnungsgemäß abgeschlossenen
Klientenzentrierten Psychotherapien” zu
beschreiben. Die vorliegenden Daten von 92
TherapeutInnen beziehen sich auf 175
Einzeltherapieprozesse und erlauben die
Beschreibung eines weitgehend repräsentativen
Bildes klientenzentrierter Praxis.
In Übereinstimmung mit früheren Studien reicht
das Spektrum Klientenzentrierter Psychotherapie
von kurzen Therapien bis zu längeren
therapeutischen Prozessen – wobei ein Großteil
der Therapien rund 20-80 Stunden umfasst. Die
Klientenzentrierte Psychotherapie kommt dabei –
im Sinne eines Breitbandkonzepts - bei sehr
unterschiedlichen Störungsbildern, darunter auch
zahlreichen schweren Störungen, zum Einsatz. Die
Ergebnisse stehen im Wesentlichen mit einer
Studie von Eckert (1994) für die BRD in
Übereinstimmung. Insgesamt bestätigt die Studie
eine gute Verankerung der Klientenzentrierten
Psychotherapie in der ambulanten
Psychotherapieversorgung in Österreich.
Humanismus und / oder
Naturalismus – Eine Auseinandersetzung zum
Menschenbild und zum Verständnis der
Aktualisierungstendenz im PCA
81-92
Im letzten
Heft der PERSON (2|2002, 26-34) erschien ein
Beitrag von Jobst Finke mit dem Titel „Das
Menschenbild des Personzentrierten Ansatzes
zwischen Humanismus und Naturalismus“. Er
reflektiert dort kritisch
naturwissenschaftliche Verständniszugänge zur
Aktualisierungstendenz und plädiert für ein
„dezidiert humanistisches, d. h.
personalistisch, subjekttheoretisch wie
kulturhistorisch begründetes Menschenbild des
PCA“.
Jürgen Kriz, derzeit der Träger der renommierten
„Lazarsfeld-Gastprofessur“ der Human- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Wien, fühlte sich durch den Beitrag
von Jobst Finke zu einer im folgenden
dargestellten pointiert formulierten Replik
veranlasst.
Diesen Beginn eines spannenden und auch für das
praktische Verständnis unserer Ansatzes
wichtigen wissenschaftstheoretischen Diskurses
zum aktuellen Verständnis des Menschenbildes
nahmen wir zum Anlass, einige Vertreter des PCA,
die sich bereits früher zu den angesprochenen
Themen geäußert hatten, um eine Stellungnahme zu
den Auffassungsunterschieden von Jobst Finke und
Jürgen Kriz zu ersuchen.
Wir hoffen, dass dies erst der Beginn einer
spannenden Auseinandersetzung ist, die den Stand
der Theorieentwicklung unseres Ansatzes im
besten Sinne aufzeigt, und würden uns über
weitere Beiträge in den nächsten Nummern der
PERSON freuen.
Christian Korunka, im Namen der Redaktion
Jürgen Kriz
Mechanistischer Humanismus
statt humanistischer Systemtheorie?
Eine
Replik auf den Beitrag von Jobst Finke
82-84
Jochen Eckert
„Entweder – Oder“ oder „Sowohl – Als auch“ oder
„Weder – Noch“, sondern nur Pappkameraden?
84-85
Günter Zurhorst
Personzentrierter Ansatz und
Neuro-Phänomenologie
Eine kurze Replik auf den
Beitrag von Jobst Finke
85-87
Christian Fehringer
Replik
auf den Beitrag von Jobst Finke
„Das Menschenbild des
Personzentrierten Ansatzes zwischen Humanismus
und Naturalismus“ 87-89
Jobst Finke
Komplexität und Differenz
Antwort auf die Replik von
Jürgen Kriz 89-91


2|2003
•
Schwerpunkt: Zur Situation der Personzentrierten Psychotherapie in Deutschland
(Hrsg. Diether Höger, Jobst Finke,
Ludwig Teusch)
Diether Höger, Jobst Finke, Ludwig Teusch
Editorial
99-100
Fachbeiträge
Reinhold Schwab, Jochen Eckert und Diether Höger
Zur Situation der Gesprächspsychotherapie (GPT) in Forschung und Lehre in
Deutschland 101-114
Informiert wird über die gegenwärtige Rolle der Klientenzentrierten
Psychotherapie in Forschung und Lehre an den deutschen mit Psychologie befassten
Universitätsinstituten und -kliniken. Dabei werden neuere Forschungsaktivitäten
und -ergebnisse berücksichtigt, ferner wird die Präsenz der GPT in der
universitären Lehre und den Lehrbüchern dargestellt. Im Ergebnis zeigt sich: Die
derzeitigen Forschungsaktivitäten sind insgesamt als nicht ausreichend zu
bezeichnen. Wenn geforscht wird, ist ein Trend zu störungsspezifischer Forschung
zu verzeichnen, bei der auch die Wirksamkeit manualgestützter Therapien
untersucht wird. In den Lehrinhalten der Universitätsinstitute und den bekannten
Lehrbüchern der Klinischen Psychologie ist die GPT vertreten, jedoch im
Vergleich zu den beiden anderen großen psychotherapeutischen Paradigmen oft
weniger gewichtig. Sorgfältig kontrollierte Forschung zu Prozessen und Effekten
der GPT halten wir weiterhin für dringend geboten, zumal anzunehmen ist, dass
die vorliegenden älteren Studien nicht mehr vollständig das abbilden, was
heutige GPT in der Praxis bedeutet.
Jürgen Kriz
50 Jahre empirische Psychotherapieforschung
Rückblicke – Einblicke – Ausblicke
115-124
Im ersten Teil, Rückblicke, wird Carl Rogers Beitrag zur Psychotherapieforschung
gewürdigt. Diese war nicht nur inhaltlich bedeutsam: neben der Entwicklung des
PCA und einer vielbeachteten Persönlichkeitstheorie war er einer der
Gründungsväter der Humanistischen Psychologie. Vielmehr war Rogers auch als
Methodiker geachtet: den angesehenen Wissenschaftspreis der APA (1956) erhielt
er für innovative Methoden in quantitativer und qualitativer
Psychotherapieforschung – dazu zählen die Einführung von Kontrollgruppe, „Q-Sort-Technik“
etc. Viele der heutigen APA-Kriterien für Psychotherapieforschung wurden von
Rogers erstmalig entwickelt.
Im zweiten Teil, Einblicke, werden die starken Einflüsse ideologie-gefärbter,
stillschweigender Annahmen diskutiert, welche den heutigen Debatten über
Psychotherapieforschung unterschwellig zugrunde liegen. Die Bedeutsamkeit der
Aspekte „Rechtfertigungsforschung“, „Prozessforschung“ und „Grundlagenforschung“
werden gegeneinander abgewogen. Ferner wird die übliche Unterscheidung in
qualitative und quantitative Ansätze kritisch hinterfragt.
In dritten Teil, Ausblicke, wird ein Plädoyer dafür gehalten, endlich die
klassisch-mechanistischen Modelle und Metaphern zu überwinden, welche (nach 350
Jahren abendländischer Wissenschaft mit ihrem Höhepunkt im 19. Jahrhundert)
selbst unsere Humanistischen Ansätzen immer noch durchziehen, und sie durch
lebensadäquatere Modelle zu ersetzen, wie sie z.B. die moderne Systemforschung
anbietet. Wenn man nämlich die mechanistischen Prinzipien (Kontrolle,
Homogenität, Geschichtslosigkeit, Linearität und Kontinuität, Statik und
einfache lokale Kausalität) durch moderne Wissenschaftsprinzipien ersetzt
(Entwicklung und Entfaltung, Emergenz, Phasenübergang, Geschichtlichkeit,
Nicht-Linearität, Dynamik, Kontexteingebundenheit und ökologisch-ganzheitliche
Kausalität), kommen wir zu Prinzipien, die den Grundanschauungen der
Humanistischen Psychologie entsprechen. Damit würde die Psychotherapie-Debatte
nicht nur den Anschluss an die interdisziplinären Diskurse gewinnen. Sondern
wichtiger wäre, dass unsere (er)-lebensfeindlichen Metaphern endlich durch
angemessenere ersetzt werden würden.
Eva-Maria Biermann-Ratjen
Das gesprächspsychotherapeutische Verständnis von Psychotrauma
128-134
Dieser Artikel beschreibt, wie im Rahmen des Klientenzentrierten Konzepts die
Entstehung, Entwicklung und Behandlung der psychotraumatogenen Pathologie
verstanden wird. Ausgehend von einer Beschreibung der Erfahrung in einer
traumatisierenden Situation wird die akute Inkongruenzerfahrung in der akuten
Belastungsreaktion, die Entwicklung der Inkongruenzerfahrung in der
Bewältigungsphase und schließlich in der posttraumatischen Belastungsstörung,
die in eine Persönlichkeitsstörung einmünden kann, beschrieben. Dissoziative
Phänomene erfahren eine besondere Beachtung. Bei der Beschreibung der
schulenübergreifenden Prinzipien der Behandlung von Psychotrauma wird betont,
dass in ihnen gesprächspsychotherapeutische Positionen – meistens nicht als
solche gekennzeichnet – eine herausragende Rolle spielen.
Schlüsselwörter: Psychotrauma, akute Belastungsreaktion, posttraumatische
Belastungsstörung, Persönlichkeitsstörung, Dissoziation.
Anette Schmoeckel
„Unter falscher Flagge segeln“?
Zur Situation der Gesprächspsychotherapie in Deutschland im Rahmen der
kassenärztlichen Versorgung
135-143
In Deutschland haben personzentriert orientierte Psychotherapeuten im ambulanten
kassenärztlichen Versorgungssystem keine Möglichkeit explizit
Gesprächspsychotherapien durchzuführen. Der Artikel skizziert die formalen und
rechtlichen Bedingungen psychotherapeutischen Arbeitens als niedergelassene
Therapeutin innerhalb des deutschen kassenärztlichen Versorgungssystems. Die
Autorin beschreibt aus subjektiver Sicht die Konsequenzen dieser Situation auf
die therapeutische Identität als Gesprächspsychotherapeutin. Weiter wird
geschildert wie der personzentrierte Ansatz gleichwohl ganz wesentlich die
konkrete therapeutische Arbeit von Gesprächspsychotherapeuten beeinflusst, auch
unter den Einschränkungen des kassenärztlichen Systems in der ambulanten
Versorgung. Der personzentrierte Ansatz hat auf hohem Abstraktionsniveau die
grundlegenden Prinzipien der Gestaltung der therapeutischen Beziehung
herausgearbeitet als Grundlage für persönliche Entwicklung und Wachstum.
Illustriert wird die Umsetzung dieser grundlegenden Prinzipien unter den
formalen Bedingungen einer tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie.
Doris Müller und Marion Thimm
Von der Persönlichkeitsentwicklung zur Faktenvermittlung?
Was bleibt nach der neuen staatlichen Ausbildungsordnung vom spezifisch
Personzentrierten in der Ausbildung zum Gesprächspsychotherapeuten?
144-150
Die besonderen Anliegen und Gütekriterien der traditionellen Ausbildung in
Gesprächspsychotherapie in der Bundesrepublik Deutschland sowie die neuen
Rahmenbedingungen der staatlichen Ausbildungsordnung werden dargestellt. Es wird
problematisiert, inwieweit die bisherigen bewährten Ausbildungsziele, -inhalte
und –methoden in den künftigen Ausbildungen verwirklicht werden können. Mögliche
Vorteile der neuen Ausbildungsordnung werden benannt und Vorschläge entwickelt,
welche Maßnahmen auch unter den veränderten Rahmenbedingungen die Qualität einer
Ausbildung in Gesprächspsychotherapie sichern könnten.
Jobst Finke und Ludwig Teusch
Schwierigkeiten und Chancen in der Personzentrierten Weiterbildung von Ärzten
151-157
Die GPT (Gesprächspsychotherapie) mit ihren Positionen der Nichtdirektivität,
der Klientenzentriertheit und der Prozessoffenheit stellt für das ärztliche
Denken etwas sehr Ungewohntes, fast Provozierendes dar. Dieses Denken wurde im
Laufe einer durch Studium und erste Berufsjahre bestimmten Sozialisation geprägt
und beinhaltet neben bestimmten kognitiven auch emotionale und aktionale
Einstellungen, die manchen Positionen der GPT entgegenstehen. Für die Situation
einer Ausbildung von Ärzten bedeutet dies eine Herausforderung sowohl für die
Auszubildenden wie die Ausbilder. Bei den offiziell anerkannten
Weiterbildungsgängen für die ärztliche Psychotherapie spielt die GPT zwar formal
nur eine Nebenrolle, doch beeinflusst sie faktisch oft sehr die
psychotherapeutische Einstellung von Medizinern. Von bestimmten Positionen der
GPT und der von den Autoren durchgeführten Weiterbildungspraxis profitieren
Ärzte in starkem Maße, jedoch ergeben sich aus manchen Positionen auch
Schwierigkeiten für die überdauernde Identifikation mit diesem Verfahren.
Ludwig Teusch und Jobst Finke
Gesprächspsychotherapie-Forschung in der Psychiatrie in Deutschland
158-163
Der personzentrierte Ansatz hat sich sowohl als therapeutisches Basiskonzept als
auch als spezifisches psychotherapeutisches Verfahren bei der psychiatrischen
Behandlung bewährt. Diese Erfahrung war die Basis für eine Reihe
wissenschaftlicher Untersuchungen, in denen die gute Wirksamkeit belegt werden
konnte, insbesondere bei Angststörungen, depressiven Störungen und
Persönlichkeitsstörungen. Vorangegangen war die Entwicklung störungsbezogener
Konzepte bis hin zu Therapiemanualen. Wenn eine Stagnation in der Forschung
vermieden werden soll, müssen junge Gesprächspsychotherapeuten mit
wissenschaftlichem Interesse gefördert werden.
Berichte
Gert-W. Speierer
Personzentrierte Ansätze in der Medizinischen Psychologie
164-167
Es wird über die Arbeit mit dem Personzentrierten Ansatz an der Abteilung für
Medizinische Psychologie an der Universität Regensburg (Deutschland) berichtet.
Dabei geht es um Forschung und Lehre zur Arzt-Patient-Kommunikation für
Studierende der Medizin, personzentrierte Selbsterfahrungsgruppen sowie
Klientenzentrierte Psychotherapie in medizinischen und ähnlichen Setting.
Sichtweisen und Positionen
der Verbände zum Personzentrierten Ansatz in Deutschland
168-174
Jobst Finke
Die ÄGG stellt sich vor
168
Jochen Eckert, Gisela Clausen, Diether Höger,
Doris Müller und Werner W. Wilk
Die Deutsche
Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie (DPGG)
169-171
Helga Kühn-Mengel
Der Personzentrierte Ansatz in Deutschland
Entwicklungen und Herausforderungen aus der Sicht der Gesellschaft für
wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG e.V.)
172-174
Nachruf
Doug Land (1929-2003)
175-177
Reinhold Stipsits
Doug Land 175-176
Peter F. Schmid
AEIOU - Doug Land und Österreich
176-177
Rezension
Margarete Letzel
Josef Giger-Bütler, "Sie haben es
doch gut gemeint". Depression und Familie
178-179

 1|2004
1|2004
•
Schwerpunkt: Der Personzentrierte Ansatz in Ostmittel- und Osteuropa
(Hrsg. Wolfgang W. Keil)
Wolfgang W. Keil
Editorial
3-4
Fachbeiträge
Ladislav Timul'ák
Einige Ergebnisse der Forschung über Significant Events in der Psychotherapie
5-12
In diesem Artikel möchte ich ausgewählte Forschungsergebnisse über Significant
Events in der Personzentrierten und Experienziellen Therapie darstellen, welche
vor allem für die therapeutische Praxis von Nutzen sein könnten. Zunächst gebe
ich eine Einführung in die Methodologie der Significant Event – Forschung. Dann
möchte ich vier Aspekte des therapeutischen Prozesses, die aus dieser Forschung
resultieren, erörtern: das Gewinnen eines Verständnisses der Therapie, auf die
man sich eingelassen hat, durch den Klienten, die Unsicherheit des Klienten über
den Therapeuten als Person und als kompetenten Experten, die Definition der
Lernergebnisse aus der Therapie durch den Klienten selbst sowie die kooperative
Teilnahme des Therapeuten am therapeutischen Prozess. Abschließend soll gezeigt
werden, welche Bedeutung diese Aspekte des therapeutischen Prozesses für die
Weiterentwicklung der Personzentrierten Psychotherapie haben könnten.
Abstract: Some Lessons Learned from Doing Research on the Significant Therapy
Events
In this paper I will focus on selected findings from significant events research
on person-centered and similar experiential approaches that can be used in the
therapeutic practice of person-centered therapy. First I will introduce the
methodology of significant events research. Then I will discuss four of therapy
process aspects encountered in this kind of research: the client’s making a
meaning from psychotherapy he or she is involved in; the client’s uncertainty
about the therapist as a person and as a competent expert; the client’s own
construal of learnings from the process of therapy; and collaborative
participation of the therapist in the course of person-centered psychotherapy.
The paper ends with showing interconnections between above presented aspects of
therapy process and their meaning for the development of person-centered therapy
Katarína Karaszová
Bedeutsame Augenblicke
in der Personzentrierten Therapie – Reflexionen einer Therapeutin
13-20
Dieser Beitrag widmet sich
der Darstellung bestimmter bedeutsamer therapeutischer Momente, wie sie sich im
Rahmen der therapeutischen Arbeit der Autorin mit zwei verschiedenen Klienten
und innerhalb verschiedener Perioden ihrer Tätigkeit ereignet haben. Die beiden
Prozesse beinhalten die Arbeit mit dem Felt Sense von bestimmten persönlichen
Schlüsselerfahrungen der Klienten, die zuvor nicht verarbeitet und integriert
werden konnten. Obwohl das Ausmaß an Prozessdirektivität der Therapeutin bei der
Arbeit mit den beiden Klienten äußerst unterschiedlich war, wurden die
jeweiligen Episoden von beiden Klienten als persönlich besonders bedeutsam
erlebt. Die Autorin betont die Wichtigkeit einer therapeutischen Beziehung,
welche von den Klienten in einer solchen Weise als sicher und zuverlässig erlebt
wird, dass sie sich bedrohlichen und schmerzvollen Erfahrungen zuwenden und
diese explorieren und integrieren können.
Abstract: Some miraculous moments in person-centered therapy - The therapist´s
reflections
The article is devoted to some of “miraculous” therapeutic moments that occured
during author´s therapeutic work with two different clients, in different phases
of her practice. Both moments were touching the work with the felt sense of some
of the client´s personally important key experience, which hadn´t been fully
processed and integrated before. Although the therapist´s degree of
process-directivity differed with each client, both episodes were described by
the clients as personally deeply meaningful. The author underlines the key role
of the therapeutic relationship percieved by the client as safe and trustworthy
enough to enable him/her to face his/her too threatening and painful
experiences, to explore and assimilate them.
Karel Hájek
Focusing als
körperliche Wirklichkeitsverankerung
21-30
In diesem Artikel wird dargestellt, wie Focusing zur körperlichen Verankerung
des Erlebens verwendet wird. Dies geschieht u. a. im Rahmen der von M. Frýba
entwickelten sogenannten Satitherapie. Zuerst wird der breitere Rahmen der vier
Wirklichkeitsverankerungen erläutert. Es folgt eine Darstellung der klassischen
Methode des Focusing und ihrer Weiterentwicklung. Dann wird kurz illustriert,
wie man das Focusing innovativ im Rahmen der psychotherapeutischen Sitzung
benützen kann. Zum Schluss folgt eine Beschreibung der qualitativen Forschung
über das körperlich verankerte Erleben, bei der Focusing als introspektive
Methode der Datengewinnung benutzt wurde.
Abstract: Focusing as bodily reality-anchoring
This article explains the way in which focusing is used for bodily reality
anchoring; this occurs, among other ways, in the context of the so-called Sati
therapy as developed by M. Frýba. First, the greater context of fourfold reality
anchoring is explained. Following this, the classic method for focusing and its
further development will be presented. Then, how one can use focusing in
innovative ways in the context of a psychotherapeutic session is shown. Finally,
the author describes the qualitative research on the bodily anchored
experiencing within which focusing is used as an introspective method for
accessing information.
Michal Pernicka
Das Phänomen der
Begegnung in der Psychotherapie
31-42
In diesem Artikel wird eine qualitative Untersuchung von Interviews mit sieben
Therapeuten aus verschiedenen therapeutischen Richtungen zum "Phänomen der
Begegnung in der Psychotherapie“ dargestellt. Diese Studie ermöglichte es, ein
derart subjektives und subtiles Moment im therapeutischen Prozess genauer unter
die Lupe zu nehmen. Bei der Beschreibung des Phänomens durch die Therapeuten
konnte dabei eine volle Übereinstimmung festgestellt werden; als wichtigste
Merkmale des Phänomens wurden angeführt: eine einzigartige Nähe und ein
Verstehen des Anderen, Vorherrschen des Erlebens statt kognitiver Aspekte, eine
hohe Intensität und kurze Dauer der Erfahrung, ein Potenzial für therapeutische
Veränderung sowie eine Motivation für die Fortsetzung der Arbeit. Zum Abschluss
dieses Artikels werden noch einige Implikationen der Begegnungserfahrung für den
therapeutischen Prozess angesprochen.
Abstract: The Encounter Phenomenon in Psychotherapy
In this study a qualitative analysis was used to process interviews with seven
psychotherapists of different theoretical approaches on the topic of "encounter
phenomenon in psychotherapy". This study enabled a closer look on these very
subjective and subtle moments in therapeutic process. An evident consensus was
reached in therapists' description of the phenomenon; its most important
characteristics showed to be: a unique closeness and understanding of the other,
emphasis on experiencing at the expense of cognitive aspects, high intensity and
short duration of the experience, a potential for therapeutic change, and
motivation for further therapeutic work. Implications of encounter experience
for therapeutic process are discussed at the end of this article.
Jan Vymětal
Geschichte,
gegenwärtige Situation und Zukunft des Personzentrierten Ansatzes in Tschechien
43-50
Die Psychotherapie hat in der Tschechischen Republik eine relativ reiche
Tradition, die auch während der Zeit der Totalitarität erhalten und
weiterentwickelt wurde und zwar auf offiziellem Niveau wie auf dem der so
genannten "Parallelstrukturen". Die gegenwärtige psychotherapeutische Szene in
der Tschechischen Republik ist vielfältig und vielseitig. Die Personzentrierte
Psychotherapie wird als vollwertiger psychotherapeutischer Ansatz angesehen und
wird in ausreichendem Ausmaß von den Krankenversicherungen bezahlt. Ihre Anfänge
bei uns sind schon zu Beginn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts anzusiedeln. In
der Gegenwart arbeiten in der Tschechischen Republik zwei PCA-Institute – eines
in Prag und eines in Brünn. Die Forschungsarbeit ist eher gering und wird an
Universitäten durchgeführt. Der Autor stellt sich kritisch zur Vermarktung der
Ausbildung und zur Überorganisiertheit der rogerianischen Bewegung.
Abstract: The history, current situation and future of the person centered
approach in the Czech Republic
Psychotherapy has a relatively rich tradition in the Czech Republic. This
tradition was maintained and further developed during totalitarian times even,
in fact, at official levels as well as at the levels of so-called "parallel
structures". The contemporary psychotherapeutic scene in the Czech Republic is
diverse and varied. Person-centred psychotherapy is recognised as completely
valid and is sufficiently financed by the medical insurance system. The roots of
the tradition can be identified already at the beginning of the 1960's.
Currently two PCA Institutions work in the Czech Republic – one in Prague and
one in Brno. Research efforts are rather limited and are conducted in the
universities. The author takes a critical stance regarding the marketing of the
training program and the "overly organised" nature of the Rogerian movement.
Berichte
Tadeusz Paciorek
Die Bedeutung des Personzentrierten Ansatzes für mich und meine Arbeit
51-54
Der Autor beschreibt, wie sich durch seine Erfahrungen in einem Cross-Cultural
Communication Workshop und bei weiteren internationalen personzentrierten
Konferenzen und Encountergruppen sein Umgang mit sich selbst und mit Anderen
nachhaltig verändert hat. Der wesentlichste Aspekt war und ist ein tiefes Gefühl
der Freiheit, sich selbst zu sein. In praktischer Hinsicht besonders interessant
ist auch die Schilderung, wie jemand, der mit dem Personzentrierten Ansatz in
seinem eigenen Land ziemlich alleine dasteht, inspiriert und getragen von der
einschlägigen Literatur und von Freunden im Ausland, seine Art des Unterrichtens
weitgreifend umstellt und studentenzentriert gestaltet.
Abstract: The impact of the person-centered approach on myself and my work
The author describes the lasting impression a Cross-Cultural Communication
Workshop and further international person-centered conferences and encounter
groups left on him, and how they changed deeply his relationship to himself and
others. The essential aspect was and remains to be a strong feeling of freedom
of being one's self. Of particular interest, from a practical point of view, is
the depiction of somebody, who, being rather isolated in his own country with
the person-centered approach, alters his style of teaching, inspired and carried
by the relevant literature and friends abroad, to attain a student-centered
nature.
Mihaela Bonatiu und Florenta Din
Klientenzentrierte
Psychotherapie in einer Strafvollzugsanstalt in Bukarest
55-58
Von den Autorinnen wurden im Rahmen ihrer Tätigkeit als Psychologinnen in einer
Strafvollzugsanstalt u. a. drei klientenzentrierte Therapiegruppen mit
Häftlingen mit unterschiedlichem Strafausmaß im Rahova-Gefängnis in Bukarest
durchgeführt. Nach einer einleitenden Schilderung des Aufgabenbereichs der
Psychologen[2]
in rumänischen Haftanstalten werden die Zielsetzungen und die geplanten
Prozessphasen der Gruppentherapie sowie die Auswahlkriterien für die Teilnahme
daran dargestellt. Der tatsächliche Verlauf der Therapiegruppen wird mittels
einer Reflexion der dabei behandelten Themenbereiche sowie mittels eines
illustrativen Ausschnitts aus dem Transkript einer Gruppensitzung skizziert. Zum
Abschluss fassen die Gruppenleiterinnen ihre Erfahrungen zusammen, indem sie
einige z. T. unerwartete Aspekte des Erlebens und Verhaltens der Teilnehmer
formulieren.
Abstract: Client-centered psychotherapy in the prison
During their work as psychologists in a penal institution, the authors formed
i.a. three client-centred therapy groups with convicts of the Rahova Prison in
Bucharest. Following an introductory depiction of a psychologists
responsibilities in Romanian penal institutions the group therapy's goals and
its planned stages of process are described, as well as the selection procedure
for participation. The actual course of the group therapy is sketched out
through a reflection of its central issues and illustrative excerpts of one
session-transcript. In their conclusion the group leaders sum up their own
experiences and formulate a number of surprising elements of the participants'
experiencing and their general conduct.
Berichte
zur Situation des Personzentrierten Ansatzes in Ostmittel- und Osteuropa
59
Nach den vorstehenden Fachbeiträgen und persönlichen Berichten, die ein
Schlaglicht darauf werfen, wie in diesem Teil Europas theoretisch und praktisch
in unserem Ansatz gearbeitet wird, folgen nun einige Beiträge, die die
Entwicklung und die derzeitige Situation der Klientenzentrierten Psychotherapie
und des Personzentrierten Ansatzes in verschiedenen Ländern Mittel- und
Osteuropas thematisieren.
Einen umfassenden Überblick über geschichtliche Entwicklung und gegenwärtigen
Status des Ansatzes geben Magda Draskóczy für Ungarn und Ladislav Timul'ák für
die Slowakei. Olga Bondarenko beschreibt die Missverständnisse, aber auch die
Hoffnungen bezüglich der Etablierung des Ansatzes in der psychotherapeutischen
Szene in Russland.
Drei weitere Beiträge sind der Darstellung einiger größerer Projekte der Aus-
und Weiterbildung in diesen Ländern gewidmet, welche wesentlich v. a. von
österreichischen bzw. von holländischen Kolleginnen und Kollegen unterstützt
werden. Sonja Kinigadner beschreibt eine Ausbildung für Klientenzentrierte
Psychotherapie der ÖGwG in Rumänien; Norbert Stölzl, Galina Pokhmelkina und
Edwin Benko berichten über eine ebensolche Ausbildung am Zentrum für Europäische
Ausbildung in Psychotherapie in Moskau. Den Abschluss bildet der Beitrag von
Marta Stapert (mit Unterstützung von Ynse Stapert, Eszter Kováts und Ioana
Serban), der einen Einblick in die vielfältigen Aus- und Weiterbildungen für
Focusing, Focusingtherapie mit Kindern und Focusing in der Supervision in Ungarn
und in Rumänien gibt.
Ergänzend sei noch erwähnt, dass uns ein geplanter Bericht über die
ausgebreitete Aktivitäten der Sektion für Klientenzentrierte Psychotherapie
innerhalb des Ukrainischen Dachverbandes für Psychotherapie leider nicht mehr
rechtzeitig erreicht hat.
Abstract: Concerning the state of the Person-Centered Approach in Central and Eastern
Europe
Following the previously presented contributions, that put a spotlight on the
theoretical and practical work in our approach in those countries, we now
proceed with further contributions that depict the development and the current
state of Client-Centered Psychotherapy and the Person-Centered Approach in
different regions of Central and Eastern Europe.
Magda Draskóczy and Ladislav Timul'ák, give a comprehensive account of the
historical development and the current status of the approach in Hungary and
Slovakia respectively. Olga Bondarenko relates the misconceptions along with the
hopes that accompany the approach's establihment in the Russian therapeutic
community.
Three further contributions give a description of prominent training projects in
those countries, that receive significant support from Austrian and Dutch
collegues. Sonja Kinigadner recounts an ÖGwG training for Client-Centered
Psychotherapy in Romania; Norbert Stölzl, Galina Pokhmelkina and Edwin Benko
report on a similar endeavour at the „Center for European Education in
Psychotherapy“ in Moscow. Finally, the contribution by Marta Stapert (with the
support of Ynse Stapert, Eszter Kováts and Ioana Serban) provides a look at the
various educational projects on Focusing, child-therapy and supervision with
Focusing in Hungary and Romania.
Unfortunately a report on the extended activities of the section for
Client-Centered Therapy of the Ukrainian Umbrella Association for Psychotherapy,
that was proposed for this issue, has not reached us on schedule.
Magda Draskóczy
Der Personzentrierte
Ansatz in Ungarn
60-62
Ladislav Timul'ák
Personzentrierte und
Experienzielle Psychotherapie in der Slowakei
63-65
Olga Bondarenko
Die Klientenzentrierte
Psychotherapie in Russland: gestern, heute und morgen
66-68
Sonja Kinigadner
Klientenzentrierte
Therapie-Ausbildung in Rumänien – Ein Projekt der ÖGwG
69-73
Norbert Stölzl, Galina
Pokhmelkina und Edwin Benko
Ausbildung in
Klientenzentrierter Psychotherapie der ÖGwG in Moskau 2000-2005
74-77
Marta Stapert, mit
Unterstützung von Ynse Stapert, Eszter Kováts und Ioana Serban
Focusing mit Kindern
und in der Supervision in Ungarn und Rumänien
78-79
Rezensionen
Lore Korbei
Eva-Maria Biermann-Ratjen, Jochen Eckert & Hans-Joachim Schwartz:
Gesprächspsychotherapie
80
Reinhold Stipsits
Marlis Pörtner:
Brücken bauen. Menschen mit geistiger Behinderung verstehen und begleiten
81
Anna Auckenthaler
Leschinsky, A.
(Hrsg.): Ursula Plog: Von einer, die auszog, die Psychiatrie das Zuhören zu
lernen
82
Wolfgang W. Keil
Strauß Bernhard, Buchheim Anna und Kächele Horst (Hrsg.): Klinische
Bindungsforschung. Theorien, Methoden, Ergebnisse
84

 2|2004
2|2004
(Hrsg. Ulrike Diethardt, Ulf Lukan
und Gerhard Stumm)
Ulrike Diethardt, Ulf Lukan und Gerhard Stumm
Editorial
90
Fachbeiträge
Gérard Mercier
Aktualisierungstendenz und Handlungsorganisation.
Zum Stellenwert der Konzeptualisierung im therapeutischen Prozess
91-101
Die Aktualisierung des
Lebenspotentials ist persönlichkeitsfördernde Aktivität. Ausgehend vom
Schemabegriff nach Piaget (1936) und dessen Weiterentwicklung nach Vergnaud
(1985; 2000) will ich deren strukturellen wie funktionellen Aspekte beschreiben.
Meine Hauptthese lautet: Die Aktualisierungstendenz drückt sich in einer
Gesamtheit von Verhaltensweisen aus, deren Teile (Ziel, Unterziel, Phasen,
Begriffe, Aktionstheoreme, Inferenzen) auf der Repräsentationsebene in
Begriffen, Bildern und Szenen abgebildet werden. Diese Elemente besitzen eine
prozessuale und tendenzielle Logik, die sowohl der mikrogenetischen Entwicklung
als auch dem durch die Beziehungserfahrung geförderten therapeutischen Prozess
gemeinsam ist.
Abstract:
Actualizing tendency and action organisation. The importance of
conceptualisation in the therapeutic process.
The actualisation of life potential is a personalizing activity. With regarding
the scheme concept defined by Piaget (1936) reconsidered and developed later by
Vergnaud (1985; 2000), my project is to describe its aspects be them structural
and functional. The main argument of this paper lays the stress on the fact that
the propension to actualisation is part of a number of behaviours which elements
(aims, sub-aims, stages, concepts and theories-in-acts, inferences) are
translated, in terms of representation, as concepts, images and scenarios
describing a processing and tendentious logic that is common to micro-genetic
development as well as the therapeutic process which is facilitated by the
relational accompaniment.
Résumé:
Tendance actualisante et organisation de l’action. La place de la
conceptualisation dans le processus thérapeutique. La place de la
conceptualisation dans le processus thérapeutique.
L’actualisation du potentiel de vie est activité personnalisante. A partir du
concept de schème défini par Piaget (1936) repris et développé par Vergnaud
(1985; 2000), mon projet est d’en décrire les aspects tant structurels que
fonctionnels.
L’argument central de cet article pose que la tendance à l’actualisation relève
d’un ensemble de conduites dont les composants (buts, sous-buts, étapes,
concepts et théorèmes-en-actes, inférences) se traduisent sur le plan de la
représentation en concepts, images et scénarios décrivant une logique
processuelle et tendancielle commune tant au développement micro-génétique qu’au
processus thérapeutique que l’accompagnement relationnel facilite.
Hermann Spielhofer
Psychotherapie als Prozess der Anerkennung
102-113
Psychotherapie, soll sie wirksam sein, besteht in der gegenseitigen Anerkennung
von Therapeut und Klient und in der Folge in der Anerkennung und Wiedererlangung
des eigenen Begehrens durch den Klienten. Für Rogers waren stets die
Einstellungen und Haltungen des Therapeuten, sein Beziehungsangebot wesentlich
für das gedeihliche Klima in der Therapie. Daneben ist jedoch für den Autor das
Beziehungsangebot des Klienten sowie dessen Rollenzuschreibungen an den
Therapeuten ein wichtiger Aspekt in der Therapie. Im Rahmen des gemeinsamen
Übertragungs-Gegenübertragungsprozesses wird eine Atmosphäre, ein
interaktioneller Raum geschaffen, in dem das abgewehrte organismische Erleben in
Form von unbewussten Inszenierungen und maskierten Botschaften, gleichsam
„zwischen den Zeilen“ einfließen kann. Damit wird die Dyade aufgebrochen durch
ein Drittes. Durch die Aufhebung in den gemeinsamen Sinn- und
Verstehenshorizont, in die symbolische Ordnung der gemeinsamen Sprache entsteht
eine triadische Struktur, die es ermöglicht, die affektive Verstrickung in der
Dyade aufzulösen. Durch die Symbolisierung des abgewehrten organismischen
Erlebens, durch die (Wieder-)Einführung in die gemeinsame Kommunikation erhält
die Sprache eine gestaltende Kraft für die Ausformung und inhaltliche Bestimmung
unseres Erlebens wie unserer Bedürfnisse und emotionalen Bewertungen. Durch die
gesellschaftlich vorgegebene Semantik und Syntax unserer Sprache kann die
Wahrheit des Begehrens oder des organismischen Selbst aufgedeckt oder auch
verschüttet werden, und Psychotherapie hat damit die Aufgabe, die Begriffe und
sprachlichen Zeichen auf ihren aufklärererischen und emanzipatorischen Gehalt
hin kritisch zu überprüfen.
Abstract: Psychotherapy as a process of acknowledgement
To be effective, psychotherapy must mutually acknowledge therapist and
client, and consequently acknowledge and re-establish the client’s own will. For
Rogers, the attitudes of the therapist and the relationship he or she offers
were always essential for a positive atmosphere in therapy. For the author,
however, the relationship offered by the client and the roles he or she
attributes to the therapist are also important aspects of therapy. In the
context of the common process of transference and counter-transference we create
an atmosphere, a space of interaction in which the denied organismic
experiencing can “flow in” in the shape of unconsciously staged interactions and
masked messages, almost “in between the lines”. In such a way the dyad is
interrupted by a third element. The integration in the common level of meaning
and understanding, in the symbolic order of the common language, gives rise to a
triadic structure, which makes it possible to dissolve the affective
entanglement in the dyad. By means of symbolisation of the denied organismic
experiencing, by means of the (re-)introduction of common communication,
language obtains a creative power for the shaping of our experiencing and for
determining its content and our needs as well as our emotional assessments. The
semantics and syntax of our language, which are socially determined, can be used
to uncover or bury the truth. Therefore it is the task of psychotherapy to
examine critically the terms and the linguistic signs with regard to their
uncovering and emancipatory potential.
Barbara Volgger, Anton-Rupert Laireiter & Joachim Sauer
Burnout bei PsychotherapeutInnen
Eine Studie bei Klientenzentrierten PsychotherapeutInnen in Österreich
114-124
Burnout ist ein häufig beobachtetes Problem psychosozialer Helferberufe. Da
bisher Klientenzentrierte PsychotherapeutInnen kaum untersucht wurden, wurde
eine Totalerhebung dieser Gruppe (N=535) in Österreich mittels DPCCQ (SPR-Collaborative
Research Network-Common Core Questionnaire), der das Maslach-Burnout-Inventory
(MBI) als Burnout-Indikator enthält, durchgeführt. 101 TherapeutInnen (=20.8%)
beantworteten die postalische Befragung. Die Ausprägung von Burnout war
insgesamt gering: Ca. 8% berichteten von hoher und weitere 25% von mittlerer
emotionaler Erschöpfung. Bivariate Analysen zeigten signifikante Zusammenhänge
zwischen Burnout und der wahrgenommenen Kontrolle über wichtige
Arbeitsbedingungen, der Anzahl behandelter PatientInnen, der Zufriedenheit mit
der therapeutischen Tätigkeit und den zur Bewältigung von Arbeitsbelastungen
eingesetzten Strategien. Keine Effekte konnten für Geschlecht, Alter, Erfahrung
und institutionelle Zugehörigkeit sowie die wahrgenommene Soziale Unterstützung
gefunden werden. Multivariante Auswertungen (Regressionsanalysen) erbrachten,
dass Burnout offensichtlich durch eine Balance aus belastenden und protektiven
Bedingungen bestimmt wird: „Zufriedenheit mit der therapeutischen Tätigkeit“
erwies sich als Burnout protektiv, „Mangel an Kontrolle über die
PatientInnenauswahl“, die Anzahl behandelter PatientInnen und negatives Coping
waren Burnout fördernd.
Abstract: Burnout in psychotherapists: A study with
client-centered therapists in Austria.
Burn-out is an often reported stressful experience in professional
helpers. Because client-centered psychotherapists have been studied rarely until
now, this group was studied with the Maslach Burnout Inventory and the German
version of the “Development of Psychotherapists-Common Core Questionnaire” (DPCCQ)
developed by Orlinsky and his coworkers from the Society of Psychotherapy
Research (SPR).. 20,8% (n= 101) of the original sample (N=535) took part in the
study. Client-centered therapists obviously do not suffer very intensively from
burnout: 8% reported intense and additional 25% mild to moderate feelings of
emotional exhaustion. Objective variables such as gender, age e.g.do not
influence burn-out as well as perceived social support, current or past personal
therapy and supervision. Linear regression analyses resulted into the conclusion
that burn-out obviously is determined by some factors. “Satisfaction with
therapeutic work” was the most important protective factor, the “number of
patients”, “not having control over patient-selection” and “avoidant and passive
coping behaviours” were the most stressful conditions which are correlated
highly with burn-out.
Franco Perino & Elena Polestra
Der Personzentrierte Ansatz in der Medizin
125-136
In diesem Artikel werden mögliche Anwendungen des Personzentrierten Ansatzes im
Gesundheitswesen analysiert, und es wird über einige Kommunikationskurse im
Arbeitsbereich eines der Autoren berichtet.
Abstract: The Person-centered Approach in the medical
field.
In this article we consider the possible applications of the
Person-centered Approach in the medical field and report our experience with
Communication-Trainings for different professional groups working there.
Edith Benkö
Psychotherapie in der kardialen Rehabilitation
Überlegungen aus klientenzentrierter Sicht
137-146
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Psychotherapie bei chronisch
körperlich kranken, nämlich herzkranken Menschen. Nach einer kurzen Beschreibung
des medizinischen Krankheitsbildes der Koronaren Herzkrankheit folgt ein
Überblick über den Stand der Theoriebildung und Forschung aus psychosomatischer
Sicht. Mögliche Ansatzpunkte für Psychotherapie unter besonderer
Berücksichtigung des Klientenzentrierten Ansatzes werden formuliert. Eine
Analyse der Behandlungsverläufe von Herzpatienten in der ambulanten
Rehabilitation mit psychotherapeutischem Versorgungsauftrag soll die
Besonderheiten und Schwierigkeiten des Zuganges von Herzpatienten zur
Psychotherapie aufzeigen und mögliche Ursachen der häufigen
Psychotherapieabbrüche dieser Patientengruppe im Beziehungsgeschehen
identifizieren.
Abstract: Psychotherapy in the cardial rehabilitation –
considerations from a client-centered view.
The following paper deals with the psychotherapeutic treatment of chronically
physically ill patients, namely people with coronary heart diseases. After a
short description of the medical symptoms of coronary heart disease, a review of
the literature of psychosomatic research as well as possible starting points for
psychotherapy (particularly Client-centered psychotherapy) will be presented. An
analysis of the development of psychotherapeutic treatment among patients with
heart disease in out-patient rehabilitation will be used to illustrate the
difficulties and unique aspects in reaching heart patients through psychotherapy
as well as attempt to explain the high drop-out rate of these patients.
Anette Murafi
Personzentrierte Therapie bei einer depressiven Klientin mit narzisstischer
Persönlichkeitsstörung
Eine Falldarstellung aus einer psychiatrischen Klinik
137-146
Die Arbeit soll den Prozess einer ca. 2-jährigen ambulanten Personzentrierten
Therapie nachzeichnen. In den verschiedenen Therapiephasen werden sowohl das
Erleben der Patientin als auch die für sie im Verlauf bedeutsamen Themen
dargestellt. Die Beziehungserwartungen in der interpersonalen Begegnung und die
sich daraus ergebenden Interventionen werden reflektiert. Schwierigkeiten in der
Verwirklichung der im Personzentrierten Ansatz postulierten idealen Beziehung
werden erörtert.
Abstract: Person-centred therapy of femal client with
major depression and narcissistic personality disorder – a case presentation
from a psychiatric hospital.
The author describes the process of a 2-year-lasting Person-centred
psychotherapy. Noting to the different steps of therapy, the author emphasizes
on the clinet’s experiencing, her main conflict themes, her relationship
expectations and the resulting therapeutic interventions. The author’s
difficulties in realization of an optimized relationship offer in order to the
Person-centred concept are discussed.
Hans-Peter Heekerens und Maria Ohling
Systemisch denken und experienziell handeln: die
Emotions-Fokussierte Paartherapie 156-163
Auf Basis der bis 2003 vorliegenden Literatur wird die Emotions-Fokussierte
Paartherapie (EFT) hinsichtlich ihres praktischen und theoretischen Ansatzes
sowie ihrer Prozess- und Ergebnisforschung vorgestellt. Die Darstellung des
Ansatzes wird in den Kontext der Frage gestellt, wie sich der experienzielle,
der systemisch-konstruktivistische und der bindungstheoretische Ansatz verbinden
lassen. Die Präsentation der Prozess- und Ergebnisforschung, nach der sich die
EFT als wirksames, effektives und effizientes Verfahren zeigt, wird eingebettet
in die Diskussion um Evidenz basierte oder evidenzbasierte Psychotherapie.
Abstract: Systemic thinking and acting experientially: the
Emotion-Focused Couple Therapy.
The purpose of this paper is to present the practical and theoretical concepts
of the Emotion Focused Couple Therapy (EFT) as well as the outcome and process
research. The portrayal of the approach is considered in the context of the
question, how experiential therapy, a systemic-constructivistic view, and
attachment theory can be combinded. The presentation of the outcome and process
research, which show EFT as an effficous, effective and efficient intervention,
is nested in the discussion concerning evidence based psychotherapy.
Robert Waldl
Personzentriertes Coaching 164-171
Zusammenfassung: Im vorliegenden Artikel wird gezeigt, dass der Personzentrierte
Ansatz nicht nur für Psychotherapie, sondern auch für Coaching ein konsistentes
Theoriemodell zur Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung sowie zu Prozess
und Beziehung bereitstellt. Coaching wird im Folgenden als eine besondere
Ausformung der von Carl R. Rogers beschriebenen hilfreichen Beziehung
analysiert. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Psychotherapie
dargestellt. Anhand der Prozessskalen von Rogers werden die Besonderheiten von
Coaching gezeigt und die Abgrenzung zur Psychotherapie verdeutlicht.
Abstract: Person-centered Coaching.
The following article shows that the Person-centered Approach provides a
reliable theoretical model, not only for psychotherapy but also for coaching
processes with regard to personality, to personal growth as well as to process
and relation. Coaching hereby will be analyzed as a special mode of the helping
relationship described by Carl R. Rogers. Similarities and differences of
coaching and psychotherapy are presented. By using Rogers’ process-scale the
characteristics of coaching are revealed and the differentiation with regard to
psychotherapy are outlined.
Würdigungen und Nachrufe
Jobst Finke und Ludwig
Teusch
Zum 80. Geburtstag von Hans Swildens
172
Nachrufe
auf Jan Rombauts (Germain Lietaer), Tony Merry (Pete Sanders) und John Keith
Wood (Charles O'Leary)
173-174
Rezension
Michael Behr
Gerhard Stumm, Johannes Wiltschko und Wolfgang W. Keil,
Grundbegriffe der Personzentrierten und Focusing-orientierten Beratung
175

 1|2005
1|2005
• Themenheft: Personzentriert und störungsspezifisch?
(Hrsg. Peter F. Schmid und Hermann
Spielhofer)
Klicken Sie hier für das Cover
Peter F. Schmid
und Hermann Spielhofer
Personzentriert und störungsspezifisch? Editorial
2-3
Fachbeiträge
Peter F.
Schmid
Kreatives Nicht-Wissen.
Zu Diagnose, störungsspezifischem Vorgehen und zum gesellschaftpolitischen
Anspruch des Personzentrierten Ansatzes 4-20
Rogers’ Persönlichkeits- und Beziehungstheorie und seine
Gegenposition zu Experteninterventionen erweisen sich bei näherem Zusehen als
herbe Gesellschaftskritik. Impliziert sein Konzept, dass „die wesentlichen
Bedingungen der Psychotherapie in einer einzigen Konfiguration bestehen“,
tatsächlich, wie seither oft behauptet, die Ablehnung von
Störungsdifferenzierung und Psychodiagnose? Und anders gefragt: Haben wir durch
die seither zahlreich entwickelten differenziellen Konzepte wirklich Neues über
die Psychotherapie dazugelernt? – Aus dialogisch-personaler Sicht sind
Therapeut und Klient nicht nur in Beziehung, sie sind Beziehung.
Das bedeutet, dass sie in jeder therapeutischen Beziehung verschieden sind. Es
ist der Klient, der den Therapeuten „in-form-iert“, d.h. in Form bringt zu
verstehen, und zum Risiko herausfordert, mit ihm eine einzigartige Beziehung zu
kokreieren. Fazit: Es ist immer die Orthopraxie, die die Orthodoxie
herausfordert.
Abstract:
Creative not-knowing. On diagnosis, disorder-specific approaches and the claim
of social criticism in the person-centered approach.
On a closer look Rogers’ theories of personality and relationship and his
counter-position to expert interventions prove themselves to constitute a harsh
social criticism. Does his conception that “the essential conditions for
psychotherapy exist in a single configuration” really imply a rejection of
disorder differentiation and psychodiagnosis, as is often claimed? Furthermore,
have the numerous conceptions of differentiation developed more recently
actually tought us something new about psychotherapy? – From a dialogical-personalistic
view therapists and clients are not only seen as being
in relationships; as persons they are relationships, which makes them different
in each therapeutic contact. It is the client who “in-forms” the therapist, i.e.
“gives him shape or form” to understand, and challenges him to take the risk of
co-creating a unique relationship. In short: It is always orthopractice that
challenges orthodoxy.
Robert Hutterer
Eine Methode für alle Fälle.
Differenzielles Vorgehen in der Personenzentrierten Psychotherapie: Klärungen
und Problematisierungen
21-41
Der Artikel befasst sich
kritisch mit dem Problem differenzieller Ansätze in der Klientenzentrierten und
Personenzentrierten Psychotherapie. Zu den zentralen Aussagen gehören: (a)
Ausgangspunkt; differenzielle Ansätze sind Antworten auf schwierige
Therapiesituationen, schwere Störungen und „schwierige“ Klienten; sie zielen auf
eine Erweiterung der therapeutischen Effektivität. (b) Differenzielle Ansätze
stellen weniger Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Klientenzentrierten
Therapie dar, sondern sind Anpassungen an vielfältige Bedingungen der Praxis und
Folge der Heterogenisierung der Anwendungsfelder, der Klienten und der
Therapeuten. (c) Differenzielle Ansätze können der Kompensation von
Einschränkungen therapeutischer Kompetenz dienen. (d) Eine differenzielle
Strategie für die erfolgreiche Ausübung des Therapeutenberufes ist eine
Strategie der Selbstselektion. Sie erfordert für den Praktiker eine
„privilegierte Position“: Die Freiheit einer psychohygienischen Lebensführung,
eine ökonomische Situation mit flexiblem finanziellem Einkommen, Rekrutierung
und „Anziehung“ einer passenden Klientel, die Verankerung in einem Netzwerk
kollegialer Kooperation.
Abstract:
One method for all cases. Differiential strategies in
person-centred psychotherapy: Clarifications and problems.
This article offers a critical exploration of differentiated strategies in
client-centred therapy. Central propositions are: (a) Differentiated concepts
are more of an adaptation to a number of practical conditions and a result of an
increasing multiplicity of applications, clients and therapists than a further
development or refinement of client-centred therapy. (b) Differentiated
strategies can serve to compensate for limitations in therapeutic competence and
to encourage a promise of success even in the case where there is insufficient
implementation of client-centred core conditions. (c) Therapists self-selection
is a differentiated strategy for the successful practice of the profession of
psychotherapy. It requires a ‘privileged position’ for the practitioner: namely,
the freedom to live a psychologically healthy life, the maintenance of an
economically viable situation with a flexible income, the ‘recruitment’ and
attraction of suitable clients (best fit strategies) and a secure position
within a network of cooperative professional colleagues.
Christian Fehringer
Brauchen wir Störungswissen, um personzentriert arbeiten zu können?
42-50
Die vorliegende Arbeit
befasst sich mit der Frage, ob wir Störungswissen brauchen, bzw. unter welchen
Bedingungen wir welches Wissen wann und wozu benötigen, und welche Kriterien für
die Entscheidungen relevant sind. Komplexe biologische, psychische oder soziale
Systeme weisen Merkmale von Vernetztheit und Rekursivität aller beteiligten
Komponenten und Prozesse auf und gewinnen damit ihre Autonomie. Personen
befinden sich in einem permanenten Prozess der selbstorganisierenden Bedeutungs-
und Informationserzeugung: Sie konstruieren ihre Wirklichkeit in ständigen
Wechselwirkungsprozessen mit der Umwelt. Neben personzentrierten Ideen ist für
diese Arbeit das Konzept der Autopoiese wesentlich. Damit verbunden sind
konstruktivistische Überlegungen und Gedanken zur Kybernetik zweiter Ordnung,
die „Objektivität“ durch Beobachtung zweiter Ordnung ersetzt. Wir beobachten wie
andere zu ihren Unterscheidungen kommen und was dadurch sichtbar oder unsichtbar
wird. „Wissen“ repräsentiert also nicht Dinge, sondern Unterscheidungen. Auf
unser Tätigkeitsfeld bezogen heißt das, wir bekommen es nicht mit den Problemen
an sich zu tun, sondern nur und ausschließlich mit den Problem-Sichtweisen der
Klienten in Bezug auf ihre Situation.
Abstract:
Do we need knowledge of psychopathology in order to be
able to work in a person-centred way?
This article looks at the question of whether we need knowledge of
psychopathology, or under which conditions we need which kind of knowledge and
when and for what, and also which criteria are relevant for our decisions.
Complex biological, psychological and social systems provide evidence that all
involved components and processes being interconnected and recursive, and thus
gain autonomy. Persons are in a permanent process of developing meaning and
information in a self-organised way: They construe their reality in continuous
processes of interaction with their environment. Apart from person-centred
ideas, the concept of autopoiesis is also relevant to this article. Connected
with this are constructivist reflections and thoughts on second order
cybernetics, which replaces “objectivity” by second degree observation. We
observe how others come to their decisions and what then becomes visible or
invisible. So, “knowledge” does not represent objects, but distinctions. That
means that in our work we are not dealing with the problems themselves, but only
and exclusively with the way clients look at their problems in their personal
situation.
Jobst Finke
Beziehung und Technik.
Beziehungskonzepte und störungsbezogene Behandlungspraxis der Personzentrierten
Psychotherapie
51-64
Da sich die Personzentrierte
Psychotherapie als „Beziehungstherapie“ versteht, sind die hier leitenden
Beziehungskonzepte zu klären. Ebenso wird untersucht, wie das Beziehungsangebot
des Therapeuten behandlungspraktisch umzusetzen ist und wie Beziehung und
Therapietechnik miteinander verknüpft sind. Ein störungsbezogener Zugang ist
sowohl prozess- wie inhaltsorientiert, d.h. er ist ausgerichtet an der Abfolge
jener The-men, die für das Erleben der jeweiligen Störung relevant sind. Am
Beispiel der Borderline-Störung werden die Schlüsselthemen dieser Störung
erörtert und ihre Bearbeitung veran-schaulicht. Es wird also die
störungsbezogene Therapiepraxis in ihren Grundzügen skizziert.
Abstract:
Relationship and technique. Concepts of relationship and
disorder specific treatment practice of person-centred psychotherapy.
Because Person-Centred Therapy is defined as a therapy of relationship it is
necessary to clarify the primary concepts of this relationship. In addition, I
attempt to explain how to integrate relationship with therapy technique, i.e.
how the therapist‘s concept of relationship is put into practice. A disorder
specific approach is both process-oriented and content-oriented, i.e. it is
considered in terms of a sequence of themes which are relevant to a particular
disorder. The key issues involved in a borderline disorder are chosen to
illuminate this approach with the intention of demonstrating how the principles
of a disorder specific approach work in practice.
Hermann Spielhofer
Selbststrukturen bei narzisstischen Störungen und Borderline-Persönlichkeiten
65-81
Im folgenden Beitrag soll die
Bedeutung von störungsspezifischen Konzepten für die Theoriebildung wie auch für
die psychotherapeutische Praxis anhand von Persönlichkeitsstörungen dargestellt
werden, und zwar insbesondere am Beispiel der narzisstischen Störungen und
Borderline-Persönlichkeitsstrukturen. Bei diesen Störungsbildern steht, im
Unterschied zu den neurotischen Störungen, nicht die Inkongruenz zwischen Selbst
und organismischem Erleben im Vordergrund, sondern die Beeinträchtigung des
Selbstkonzepts.
Zur Darstellung und Begründung narzisstischer Störungen und
Borderline-Persönlichkeitsstrukturen, erscheint es daher notwendig, die
Entwicklung des Selbst und die Ausbildung der Selbststrukturen aufzuzeigen. Ich
greife dabei auf theoretische Konzepte der Selbstpsychologie, der
Objektbeziehungstheorie sowie der empirischen Säuglingsforschung zurück, um im
Lichte dieser Theorien und Erkenntnisse die theoretische Konzeption des Selbst
im Rahmen des Personzentrierten Ansatzes zu diskutieren und weiterzuentwickeln.
Es geht um die Topographie der Selbststruktur als Modell zur Darstellung und
Begründung von Selbsterleben.
Stichwörter: Borderline-Persönlichkeit, narzisstische Störung,
Persönlichkeitsstörungen, Selbst, Selbststruktur.
Abstract: Self-structures in narcissistic disorders and
borderline personalities.
In this article the significance of disorder-oriented concepts for both the
development of theories and the practice of psychotherapy is described on the
basis of personality disorders, particularly of narcissistic and borderline
disorders. As opposed to neurotic disorders, where the incongruence between self
and organismic experience is in the foreground, the disturbance of the
self-concept is regarded as the primary cause of personality disorders
In order to describe and find reasons for narcissistic and borderline disorders
it seems necessary, to illustrate the development and structure of the self. For
this the author refers to theoretical concepts of self-psychology, object theory
and empirical infant research in order to discuss and develop the conception of
self within the person-centred approach in the light of these theories. We have
to develop a topography of a structure of self for a model to found the
self-experience.

AKTUELLE
AUSGABE
 2|2005
2|2005
•
Selbstorganisation (Salzburg-Kongress
2004)
Franz Berger, Robert Hutterer und Christian Korunka
Editorial
91
Fachbeiträge
Gerald Hüther
Selbstorganisierte Strukturierung und nutzungsbedingte
Modifikation neuronaler Verschaltungsmuster – Implikationen für die
Psychotherapie 92-98
Psychosoziale Konflikte sind
die wichtigsten Auslöser emotionaler Reaktionen. Die damit einhergehende
neuroendokrine Stressreaktion führt im Fall kontrollierbarer Probleme
(„Herausforderungen“) zur Stabilisierung und Bahnung der individuell zur
Bewältigung eingesetzten Strategien und der dabei aktivierten neuronalen
Verschaltungen. Individuell als unkontrollierbar empfundene Probleme
(„Bedrohungen“) bewirken wesentlich tief greifendere und länger anhaltende
emotionale Aktivierungsprozesse, die zur Destabilisierung der bereits
entstandenen, zur Problemlösung jedoch ungeeigneten assoziativen Verschaltungen
führen. Die Bedeutung derartiger, stressmediierter Stabilisierungs- bzw.
Destabilisierungsprozesse für die adaptive, erfahrungsabhängige Anpassung
verhaltenssteuernder neuronaler Netzwerke wird in diesem Beitrag
herausgearbeitet und die möglichen Entgleisungen dieses Anpassungsprozesses
werden beschrieben.
Abstract: Psychosocial conflict
is the major cause of emotional arousal and the activation of the neuroendocrine
stress response. The higher associative brain structures are not only the sites
in which psychosocial demands are recognized and from which a less or more
systemic, i.e. controllable or uncontrollable stress response is initiated. They
are also the sites which are structurally modified in the course of this
response: Controllable stress leads to the stabilization and facilitation if
those neuronal pathways and synaptic connections which are activated in the
coping process, uncontrollable stress favours the destabilization of established
associative networks as a prerequisite for their subsequent reorganization. The
stress response acts therefore as a trigger for the adaptive,
experience-dependent adjustment of neuronal connectivity to the actual, i.e.
individually perceived, demands of the external, psychosocial world.
Andrea Hammer
Innere Bilder und Affektabstimmung
99-106
Klientinnen, die in früher Kindheit unzulängliche
Erfahrungen beim Teilen von kognitiven und affektiven Zuständen mit anderen
Menschen machen konnten, zeigen in der Therapie häufig Probleme, das
Beziehungsangebot der Therapeutin wahrzunehmen. Da ihre Selbstkonfiguration
präsymbolisch ist, reicht Sprache oft nicht aus, diese Klientinnen zu erreichen.
Viele Erfahrungen sind in Bildern gespeichert. Gelingt es, diese hervorzuholen
und mit Hilfe der Therapeutin mit alten Erfahrungen zu verknüpfen, kann bei
diesen früh gestörten Klientinnen das Selbst gestärkt und die blockierte
Aktualisierungstendenz wieder zum Fließen gebracht werden.
Abstract: Clients, who had insufficient experiences with
sharing cognitive and affective states with others, often show problems in
therapy to realize that the therapist is offering contact. The verbal
communication isn´t enough to reach them, that´s because their configurations of
self are presymbolic. Many experiences are stored in images. If it is possible
for the therapist to reactivate these stored images and connect them with
earlier experiences, then the self configurations of clients with a fragile and
dissociated personality will be supported, thus the blocked actualizing tendency
will be brought into a state of flux.
Thomas Oberlechner
Metaphern in der Psychotherapie
107-112
Dieser Artikel diskutiert die
Wichtigkeit von Metaphern in der Personzentrierten Therapie. Die Bedeutung von
Metaphern für menschliches Erleben wird in so komplexen Organisationen wie
Finanzmärkten deutlich, deren Abstraktion erst durch Metaphern begreifbar wird.
In der Psychotherapie symbolisieren Klienten und Therapeuten schwer zu
beschreibende Gefühle und Erfahrung durch Metaphern. Der Artikel beschreibt
metaphernrelevante Therapieaspekte (zum Beispiel Selbst, Beziehung und
Veränderung) und wichtige Funktionen von Metaphern in der Therapie (zum Beispiel
Beziehungsaufbau und Symbolisierung von Emotionen). Metaphern hängen mit
Therapieverlauf und Therapieerfolg ebenso zusammen wie mit dem zentralen
personzentrierten Konzept der Empathie. Darüber hinaus reflektieren Metaphern
Vorstellungen über Therapie und das Selbst. Ein personzentrierter Zugang zur
Metapher ist auf die persönlichen Bedeutungen und Erfahrungen in den Metaphern
der Klienten ausgerichtet.
Abstract: This article
discusses the importance of metaphors in person-centered therapy. The meaning of
metaphors for human experience becomes evident in such complex organizations as
financial markets, whose abstraction becomes tangible only through metaphors. In
psychotherapy, clients and therapists symbolize hard-to-describe feelings and
experience through metaphors. The article describes metaphorically relevant
aspects of therapy (for example, self, relationship, and change) and important
functions of metaphors in therapy (for example, relationship building and the
symbolization of emotions). Metaphors are connected to the course and success of
therapy as well as to the core person-centered concept of empathy. Furthermore,
metaphors reflect concepts about therapy and the self. A person-centered
approach to metaphor is directed at the personal meanings and experiences in the
clients’ metaphors.
Walter Kabelka
Das Inhumane in Modellen der Selbstorganisation
113-112
Der Beitrag diskutiert den problematischen
Transfer einzelner Bestandteile der Systemtheorie in die Beschreibung von
Konfliktsituationen, ohne dass notwendige Bewertungen von Sachverhalten
vorgenommen werden. Menschliche Aktivität wird sowohl als Element von Prozessen
der Selbstorganisation wie auch unter dem Gesichtspunkt autonomer Verantwortung
betrachtet. Die mögliche Diskrepanz zwischen einer funktionalistischen und einer
ethischen Sichtweise wird thematisiert und daraus abgeleitet, dass die
systemisch begründete Relativierung von Sichtweisen dazu verwendet werden kann,
eine Unterscheidung zu verweigern. Weiters wird ein Autonomiebegriff diskutiert,
der nur auf eine biologisch gegebene Konstitution Bezug nimmt und in dieser
Reduktion nicht als Fundament für ethische Folgerungen genügt.
Abstract: This article discusses the problematic
transfer of single parts of the systems theory into the description of
situations of conflicts without a necessary valuation of factual situations.
Human activity is seen both as an element of processes of self-organization as
well as from the point of view of autonomic responsibility. There might be a
disunity between a functionalistic and an ethic view to human activity which
could lead to refusing a distinction by arguing with relativity of views. The
term of autonomy is discussed in its reduction to an only biological
constitution. As such it is not sufficient for ethical conclusions.
Dennis Danner
Wenn das klientenzentrierte Beziehungsangebot am Ende
ist.
Die Helfer-Klient-Kollusion als Ressource 123-130
Der Klientenzentrierte Ansatz zielt auf die
Förderung der Selbstexploration mittels eines spezifischen, humanistisch
geprägten Beziehungsangebots, damit Klienten ihre Inkongruenzen bewältigen
können. Dieses Beziehungsangebot ist für die Identität der Personzentrierung
unverzichtbar. Und doch zeigt unsere alltägliche Erfahrung: wir können so
grundsätzlich an Klienten scheitern, dass wir es nicht mehr verwirklichen
können. Wie kann sich die Klientenzentrierung angesichts dieser Grenze als
eigenständiges Verfahren weiterentwickeln, um Klienten und professionellen
Helfern gerecht zu werden und damit konkurrenzfähig zu bleiben? Der vorliegende
Artikel schlägt eine Lösung vor, wie das Potential der Personzentrierung gerade
an dieser Grenze entfaltet werden kann: das Beachten des gemeinsamen Scheiterns
öffnet den Weg zum notwendigen Wachstumsprozess. Denn in der kollusiven
Verstrickung können wir den Zugang zu den beiderseitigen, unbewältigten
Verletzungen entdecken.
Brigitte Wakolbinger
Mutterschaft und Personzentrierte Psychotherapie
131-141
Ausgehend von meinen ganz
persönlichen Erfahrungen als Personzentrierte Psychotherapeutin und Mutter
zweier Kinder stelle ich in diesem Artikel dar, wie Mutterschaft und
Personzentrierte Psychotherapie sich gegenseitig befruchten können. Weiters gehe
ich darauf ein, inwieweit Ergebnisse aus der Säuglingsforschung und klinischen
Bindungsforschung zu mütterlichem Verhalten für die personzentrierte
Theoriebildung förderlich sein können. Ich möchte Kolleginnen mit diesem Artikel
ausdrücklich dazu ermuntern, diesen einzigartigen Erfahrungsschatz des
Mutterseins selbstbewusst in ihr Selbstbild als Personzentrierte
Psychotherapeutinnen zu integrieren.
Abstract: Based on my very
personal experience as person centred psychotherapist and as two children’s
mother I show how motherhood and person centred approach are really stimulating
each other. Furthermore I discuss in which extent the results of research in the
fields of child development and attachment behaviour related to maternal
behaviour could be useful for the further development of the person centred
theory. I would like to expressly encourage women to confidently integrate their
unique wealth of experience to be a mother into their self image as person
centred psychotherapists.
Elfriede M. Ederer
Der Einsatz von Neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien (NIKT) als Unterstützung des Literaturstudiums und
der Kommunikationsmöglichkeiten im Rahmen eines Seminars zur Personzentrierten
Gesprächsführung an der Universität.
Ein Praxisbericht über ein medienbasiertes Lernarrangement 142-156
Zielsetzung dieses Beitrages ist es, die Möglichkeiten von eLearning bei der
Vermittlung des Personzentrierten Ansatzes (PCA) im Rahmen einer
Lehrveranstaltung im Bakkalaureatsstudium (Bakkalaureat wird in Österreich für
Bachelor verwendet) Pädagogik an der Universität Graz aufzuzeigen. Nachdem auf
Möglichkeiten eingegangen wird, die sich für das Erlernen von Gesprächsführung
unterstützt durch NIKT ergeben, werden die unterschiedlichen
Kommunikationsszenarien von medienbasierten Lernarrangements und der
eLearning-Varianten dargestellt. Auf dem Hintergrund der für das Lernen von
Gesprächsführung relevanten Lernparadigmen und Instruktionsdesigns wird der
Seminarablauf eines medienbasiert durchgeführten Gesprächsführungsseminars
geschildert, in dem Präsenz- und Online-Phasen im Sinne des Blended Learning
kombiniert werden. Die Darstellung soll dazu anregen, didaktische
Gestaltungselemente der Lehrveranstaltung auch in die Psychotherapieausbildung
zu übernehmen, ist doch die Nutzung verschiedener Informations- und
Kommunikationstools eine Voraussetzung für internetgestützte Beratungsformen,
deren Bedeutung weiter zunimmt.
Abstract: This contribution aims at outlining the possible applications of
e-learning for teaching the Person-Centred Approach (PCA) in a course within the
baccalaureate degree in education at the University of Graz. A discussion of the
new opportunities offered by NICT for the acquisition of communication skills is
followed by a presentation of the various communication scenarios of media-based
learning arrangements and of the different e-learning options. Against the
background of the learning paradigms and instructional designs that are relevant
with regard to the teaching of communication skills we will trace the
progression of a media-based communication seminar which combines concepts of
classroom sessions and online sessions in a blended learning arrangement. The
presentation suggests the integration of some of the didactical design elements
of this course into psychotherapy training programs, since the utilization of
different information and communication tools is a prerequisite for
internet-assisted forms of counselling, which are becoming increasingly
important.
Franz Kraßnitzer
Carl und Bob.
Der Personzentrierte Ansatz im Wechselspiel mit bzw. als Teil der amerikanischen
Populärkultur 157-163
Die europäische
personzentrierte Community hat es mit einer nordamerikanischen Erfindung zu tun.
Und vielleicht ist auch darin begründet, dass es oft eine gewisse
Herausforderung darstellt, Kongruenz zwischen Theorie und Praxis anzustreben.
Von den vielen Eigenheiten, die die Vereinigten Staaten von Amerika ausmachen
und somit auch die Person Carl Rogers beeinflusst haben, sollen einige erinnert
werden: die Besiedlung und Begründung durch protestantische Europäer
(Puritanismus), die typisch amerikanische Philosophierichtung des Pragmatismus
und einige populäre Hervorbringungen der amerikanischen Kultur während jener
Zeit, in der Carl Rogers, „Amerikas einflussreichster Berater und
Psychotherapeut – und einer seiner prominentesten Psychologen“ (Kirschenbaum,
2002, S. 5), tätig war.
Abstract: The European
Person centered community has to deal with an invention from North America.
Maybe that is the reason why it is such a challenge to congruently link theory
with practice. Some of the specifities which made up the United States and which
have influenced also Carl Rogers, some will be mentioned: The foundation of the
United States by protestant Europeans (Puritanism), the typical American
phisosophy of pragmatism, and some of the popular outcomes of the American
culture in the times of Carl Rogers. He was at this times the “Americas most
influencial counsellor and psychotherapist and one of the most prominent
psychologist” (Kirschenbaum, 2002, p. 5).
Rezensionen
Gerhard Stumm
Jobst Finke, Gesprächspsychotherapie. Grundlagen und
spezifische Anwendungen. 3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage
164-165
Christian
Fehringer
Arist von
Schlippe / Willy Christian Kriz (Hrsg.), Personzentrierung und Systemtheorie
Perspektiven für psychotherapeutisches Handeln 166
Hermann
Spielhofer
Arist von
Schlippe / Willy Christian Kriz (Hrsg.), Personzentrierung und Systemtheorie
Perspektiven für psychotherapeutisches Handeln 167-171
Ilse
Freyenschlag und Christine Wakolbinger
Sonja
Bieg / Michael Behr, "Mich und Dich verstehen" - Ein Trainingsprogramm zur
emotionalen Sensitivität bei Schulklassen
und Kindergruppen im Grundschul- und
Orientierungsstufenalter 172
Diether Höger
Gerhard Stumm / Alfred Pritz / Paul
Gumhalter / Nora Nemeskeri und Martin Voracek (Hrsg), Personenlexikon der
Psychotherapie 173
Gerhard Stumm
Lisbeth Sommerbeck, The client-centered therapist in
psychiatric contexts.
A therapist's guide to the
psychiatric landscape and its inhabitants
164-165

VORSCHAU:
 1|2006
1|2006
•
Der Personzentrierte Ansatz in der Medizin
(Arbeitstitel)
•
Weiterer Beitrag
John Keith Wood
Großgruppenarbeit und der „Zustand der Mitte“.
Die Auswirkungen von Gruppe, einfühlsamem Dialog und innovativem Lernen
übersetzt von Silvia Zanotta und Peter F.
Schmid
In diesem Aufsatz stellt John Wood, einer der
Pioniere personzentrierter Großgruppenarbeit, die Erfahrungen in großen
Encounter-Gruppen in einen breiten kulturellen Zusammenhang, vor allem
hinsichtlich außergewöhnlicher Bewusstseinszustände („Zustand der Mitte“). Er
beschreibt deren Bedingungen und Wirkungen, die Notwendigkeit sorgfältiger
Vorbereitung und Organisation von Großgruppen-Workshops, die möglichen
außergewöhnlichen Lernerfahrungen und deren Bedeutsamkeit für die
Psychotherapie. (Redaktion)
Abstract: Large group
work and the “middle state”. The effect of group, sensible dialogue, and
innovative learning.
In this paper John Wood, one of the pioneers of person-centred work in large
groups, discusses the experiences in large group encounters within a broad
cultural framework, particularly regarding exceptional mental states (“the
middle state”). He describes its conditions and outcomes, the necessity of
careful preparation and organization of large group workshops, their possible
extraordinary learning experiences and the significance for psychotherapy.
 2|2006
2|2006
•
Personzentrierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
(Arbeitstitel)
 1|2007
1|2007
•
Freie Beiträge
 2|2007
2|2007
•
Wirksamkeitsforschung und Qualitätssicherung (Arbeitstitel) - Schwerpunktheft
 1|2008
1|2008
•
Psychotherapiedidaktik (Arbeitstitel) -
Schwerpunktheft
 2|2008
2|2008
•
Gesellschafts-/gesundheitspolitische Herausforderungen (Arbeitstitel) -
Schwerpunktheft

REGISTER
Hefte
1 | 1997 – 1|2005
Schwerpunkthefte
•
10 Jahre nach dem Tod von Carl Rogers — Das Vermächtnis als Herausforderung,
Schwerpunktheft 1|1998
•
100 Jahre Carl Rogers, Schwerpunktheft 2|2001
•
Der Personzentrierte Ansatz außerhalb der Psychotherapie, Schwerpunktheft
1|1999
• Der Personzentrierte Ansatz im Spannungsfeld
zwischen wissenschaftlicher Theorie und gelebter
Praxis, Schwerpunktheft 1|2003
• Der
Personzentrierte Ansatz in Ostmittel- und Osteuropa,
Schwerpunktheft 1|2004
•
Klienten–/Personzentrierte Psychotherapie am Wiener Weltkongreß 1996,
Schwerpunktheft 1|1997
•
Person-/Klientenzentrierte Supervision, Schwerpunktheft 2|2000
• Personzentriert und störungsspezifisch?
• Zur
Situation der Personzentrierten Psychotherapie in Deutschland, Schwerpunktheft 2
| 2003
Beiträge
Auckenthaler, Anna (2001),
Die Gesprächspsychotherapie vor dem Hintergrund
aktueller Entwicklungen in Klinischer Psychologie
und Psychotherapie, in: PERSON 2 (2001)
98-102
Bahr, Christiane
(1999), Entwicklungspsychologische
Möglichkeiten im höheren Lebensalter am praktischen Beispiel des Sozial– und
Gesundheitszentrums Gnig, in: PERSON 1 (1999) 69-75
Barrett-Lennard,
Godfrey
T. (2001),
Levels of loneliness and connection: Crisis and possibility, in: PERSON 1 (2001)
58ff
Behr, Michael / Doubcek, Nicole / Höfer, Steffi
(2002), Authentizität als Einheit.
Authentizität als Einheit von Erfahrung,
Selbstkonzept und Echt-Sein am Beispiel von
unterrichtenden Lehrern,
in: PERSON
2
(2002)
60-70
Benkö, Edith
(2004), Psychotherapie in der kardialen Rehabilitation.
Überlegungen aus klientenzentrierter Sicht, in: PERSON 2 (2004)
137-146
Berger,
Franz (2003),
Veränderungsepisoden und Bedeutungskonstruktion im
Personzentrierten Therapieprozess,
in: PERSON 1 (2003)
29-36
Biermann–Ratjen, Eva–Maria (1997), Eine
klientenzentrierte Krankheitslehre, in: PERSON 1 (1997) 48–55
Biermann–Ratjen, Eva–Maria (1998),
Das Phänomen Aggression betrachtet im Rahmen der Klientenzentrierten
Entwicklungspsychologie, in: PERSON 1 (1998) 64–68
Biermann-Ratjen, Eva-Maria (2001),
Zur Entwicklungspsychologie von Rogers, in: PERSON
2 (2001) 38-42
Biermann-Ratjen, Eva-Maria (2003),
Das gesprächspsychotherapeutische Verständnis von Psychotrauma, in: PERSON 2
(2003) 128-134
Bonatiu, Mihaela / Din, Florenta (2004),
Klientenzentrierte Psychotherapie in
einer Strafvollzugsanstalt in Bukarest, in: PERSON 1 (2004) 55-58
Bondarenko, Olga (2004),
Die Klientenzentrierte Psychotherapie in Russland:
gestern, heute und morg
en,
in: PERSON 1 (2004) 66-68
Böhnisch, Wolf R. / Freisler-Traub, Andrea
/ Frenzel, Peter (1999), Ein personzentrierter Ansatz in der
Hochschuldidaktik. Bericht und Reflexion zu einem selbstgesteuerten
Lernexperiment im (wirtschafts)universitären Kontext, in: PERSON 1 (1999) 38-46
Brossi, Rosina
(2003),
Unzeitgemäss?
Gedanken
einer Praktikerin zum Thema Langzeittherapien,
in: PERSON 1 (2003)
57-65
Bruckbäck, Maria (1997), Die
Verbalisation des Selbst, in: PERSON 1 (1997) 72–74
Butterfield–Meisel, Christine / Hadinger,
Boglarka / Keil, Wolfgang W. / Kurz, Wolfram / de Mendelssohn, Felix / Schmid,
Peter F. / Schwager–Scheinost, Marianne (1997), Dialog der Schulen: Ähnlichkeiten
und Differenzen. Podiumsdiskussion im Rahmen des Weltkongresses für
Psychotherapie 1996, in: PERSON 1 (1997) 25–39
Cain, David J. (2001),
„Die Fakten sind freundlich“.
Belege aus der
Forschung für die Effizienz der
Klientenzentrierten und Experienziellen
Psychotherapien,
in: PERSON 2 (2001) 29-31
D
de Peretti, André (2002),
Die Globalisierung, der Personzentrierte Ansatz
und die Kultur des Barock, in: PERSON 1 (2002)
88-94
Diethardt, Ulrike / Korunka, Christian (2000),
Editorial, in:
PERSON 1 (2000) 3
Diethardt,
Ulrike / Letzel, Margarethe (2003),
Der
Personzentrierte Ansatz im Spannungsfeld zwischen
wissenschaftlicher Theorie und gelebter Praxis.
Editorial, in: PERSON 1 (2003) 3
Draskóczy, Magda (2004), Der Personzentrierte Ansatz in Ungarn,
in: PERSON 1 (2004) 60-62
Eckert, Jochen (1997),
Welcher Klient
mit welcher Störung profitiert von einer Gesprächspsychotherapie? Entwicklung
und Stand der Indikationsfrage in der Klientenzentrierten Psychotherapie, in:
PERSON 1 (1997) 40–47
Eckert, Jochen (2001), Zur Entwicklung
der klientenzentrierten Psychotherapieforschung,
in: PERSON 2 (2001) 27f
Eckert,
Jochen
(2003),
„Entweder – Oder“ oder „Sowohl – Als auch“ oder
„Weder – Noch“, sondern nur Pappkameraden?
, in: PERSON 1 (2003)
84-85
Eckert, Jochen / Clausen, Gisela / Höger, Diether /
Müller, Doris / Wilk, Werner W. (2003), Die Deutsche Psychologische
Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie (DPGG), in: PERSON 2 (2003) 169-171
Fairhurst, Irene (2001),
Das Werk von Carl Rogers aus einer feministischen
Perspektive, in: PERSON 2 (2001) 48-50
Fartacek, Reinhold (1999), Aspekte
Klientenzentrierter Psychotherapie in der Psychiatrie
am Beispiel einer stationären Krisenintervention, in: PERSON 1 (1999) 25-31
Fehringer,
Christian (2003), Eine essayistische
Beschreibung von Supervisionsprozessen, in: PERSON
1 (2003) 24-28
Fehringer,
Christian (2003), Replik auf den Beitrag von
Jobst Finke, „Das Menschenbild des
Personzentrierten Ansatzes zwischen Humanismus und
Naturalismus“, in: PERSON 1 (2003) 87-89
Christian Fehringer (2005), Brauchen wir
Störungswissen, um personzentriert arbeiten zu können?, in: PERSON 1 (2005)
42-50
Fennes,
Irmgard (2001),
Im Prozess der Wandlung. Spirituelle Aspekte in der Personzentrierten
Psychotherapie, in: PERSON 1 (2001) 32ff
Finke,
Jobst (1999), Das Verhältnis von Krankheitslehre und
Therapietheorie in der Gesprächspsychotherapie, in: PERSON 2 (1999) 131-138
Finke, Jobst (1999), Rezension: Peter F.
Schmid, Im Anfang ist Gemeinschaft. Bd.
III: Personzentrierte Gruppenarbeit in Seelsorge und Praktischer Theologie,
Stuttgart (Kohlhammer) 1998, in: PERSON 2 (1999) 131-138
Finke,
Jobst (2001), Rezension: Dietrich
H. Moshagen (Hrsg.), Klientenzentrierte Therapie bei Depression, Schizophrenie
und psychosomatischen Störungen, in: PERSON 1 (2001) 77ff
Finke,
Jobst (2001),
Die
Therapietheorie der Personzentrierten
Psychotherapie, in: PERSON 2 (2001) 34-36
Finke, Jobst (2002), Das Menschenbild des
Personzentrierten Ansatzes zwischen Humanismus und
Naturalismus,
in: PERSON 2 (2002)
26-34
Finke, Jobst
(2002),
Der Kampf um Anerkennung. Die Geschichte der
öffentlich-rechtlichen Etablierung der
Gesprächspsychotherapie in Deutschland,
in: PERSON 2 (2002)
71f
Finke, Jobst (2003), Die ÄGG stellt sich vor, in:
PERSON 2 (2003) 168
Finke,
Jobst (2003),
Komplexität und Differenz. Antwort auf die Replik
von Jürgen Kriz,
in: PERSON 1 (2003)
89-91
Jobst Finke (2005), Beziehung und Technik.
Beziehungskonzepte und störungsbezogene Behandlungspraxis der Personzentrierten
Psychotherapie, in: PERSON 1 (2005)
51-64
Finke, Jobst / Teusch, Ludwig
(2003),
Schwierigkeiten und Chancen in der Personzentrierten Weiterbildung von Ärzten,
in: PERSON 2 (2003) 151-157
Finke, Jobst / Teusch, Ludwig (2004), Zum 80. Geburtstag von Hans Swildens,
in: PERSON 2 (2004)
172
Frenzel,
Peter (1997), Fortschritte in der
eigenen Identitätsentwicklung. Bericht über die Vierte Internationale
Konferenz für Klientenzentrierte und Experientielle Psychotherapie, Lissabon,
Juli 1997, in: PERSON 2 (1997) 116–119
Frenzel, Peter (1998), Vielfalt
versus Beliebigkeit. Wie das Vermächtnis von Carl R. Rogers im Institut für
Personzentrierte Studien (IPS) als Herausforderung verstanden wird, in:
PERSON 1 (1998) 45–56
Frenzel Peter (1999), Editorial, in:
PERSON 2 (1999) 99f
Frenzel,
Peter (2000), Personzentrierte
Supervision. Entwicklung durch dialogische Kreation funktionaler Wirklichkeiten
in einer Umwelt der Organisation,
in: PERSON 2 (2000) 28-39
Fuchs, Renata (1999), Personzentrierte
Beratung bei Arbeitslosigkeit, in: PERSON 1 (1999) 76-80
Garbsch,
Madeleine
(2000),
Geschichte der Psychotherapieforschung. Welchen Beitrag hat der
Personzentrierte Ansatz geleistet?,
in: PERSON 1 (2000) 32-42
Gaul, Sylvia (1998), Carl
Rogers — Legitimität der Nachfolge im Spiegel person(en)/klientenzentrierter
Vereinigungen in Österreich, in: PERSON 1 (1998) 57–63
Gaul,
Sylvia (2001),
Rezension: Barrett-Lennard, Godfrey, Carl Rogers' helping
system. Journey and substance, London (Sage) 1998,
in: PERSON 1 (2001)
74ff
G
aul,
Sylvia / Sauer, Joachim (1999),
Editorial, in:
PERSON 1 (1999) 3f
Gaylin,
Ned L. (1997), Client–Centered
Family Therapy. Individual and ecosystemic issues, in: PERSON 1 (1997) 82–85
Graf, Walter / Pfingstner, Reinhold (1999),
Personzentrierte Outdoorarbeit — Begegnung in der Natur, in: PERSON 1
(1999) 11-15
Greening, Tom (2001),
Carl Rogers als “direktiver” Psychotherapeut,
in: PERSON 2 (2001)
37
Gutberlet,
Michael (1999), Die
Entfaltung von Personal Power im Personzentrierten Ansatz. Vortrag zum ÖGwG-Symposium
21.-23. Mai 1998 in
Linz, in: PERSON 2 (1999) 101-109
Gutberlet, Michael (2001),
Friedensarbeit im Sinne von Carl Rogers beginnt in
der Person. Jetzt! in: PERSON 2 (2001) 45-47
Gutberlet, Michael (2003),
Die
personzentrierte Haltung: die Kraft, die
Veränderung schafft? Über die Schwierigkeiten des
Verstehens und Vermittelns von Rogers’ sanfter
Revolution,
in: PERSON 1 (2003)
15-23
Hájek, Karel (2004),
Focusing als körperliche Wirklichkeitsverankerung,
in: PERSON 1 (2004) 21-30
Heekerens, Hans-Peter / Ohling, Maria
(2004), Systemisch denken und experienziell handeln: die
Emotions-Fokussierte Paartherapie, in: PERSON 2 (2004) 156-163
Hegar,
Karin / Katsivelaris, Margret / Kucera,
Martina / Margulies, Frank / Rehrl, Michael /
Schwarz, Michael / Theurer, Maria / Tichy, Harald
E. (2001),
Zur Aktualität des Rogersansatzes in der heutigen
Psychotherapie-Ausbildung. Statements von
Ausbildungsteilnehmer/innen aus der APG, ÖGwG und
SGGT, in: PERSON 2 (2001) 109-117
Heimerl
Bernd / Frohburg, Inge (2002),
Empathie in der
psychotherapeutischen Praxis. Eine empirische
Untersuchung zur Frage ihrer Dimensionalität, in:
PERSON 1 (2002) 59-64
Heinerth, Klaus (2003),
Woran
erkenne ich, dass Veränderung beim Klienten
geschieht? ,
in: PERSON 1 (2003)
51-56
Hendricks Gendlin,
Marion N. (2002),
Ein Felt Sense ist mehr als nur ein Gefühl,
in: PERSON 2 (2002)
19-25
Holdstock,
T. Len (1997), Paradoxes
and challenges facing the person-centered approach, in: PERSON 1 (1997) 56–61
Höger,
Diether
/
Finke, Jobst / Teusch, Ludwig (2003),
Editorial,
in: PERSON 2 (2003)
99-100
Höger,
Diether / Müller,
Doris (2002),
Die Bindungstheorie als Grundlage für das
empathische Eingehen auf das Beziehungsangebot von
Patienten,
in: PERSON 2 (2002)
35-44
Hutterer, Robert (2005), Eine Methode für alle Fälle.
Differenzielles Vorgehen in der Personenzentrierten Psychotherapie: Klärungen
und Problematisierungen.
in: PERSON 1 (2005)
21-41
IPS der APG und ÖGwG (1997),
Person–/Klientenzentrierte
Supervision und Organisationsentwicklung. Statut und Ausbildungsordnung von ÖGwG
und IPS der APG, in: PERSON 2 (1997) 160–167
Jandl–Jager, Elisabeth (1998), Psychotherapieforschung
und Psychotherapeutische Praxis, in: PERSON 1 (1998) 69–74
Kabelka, Walter (1999),
Bericht vom
Symposium der ÖGwG im Mai 1998, in: PERSON 1 (1999) 85f
Kahn,
Ed (1999), The
Intersubjective Perspective and the Person-Centered Approach. Are They One at
Their Core?, in: PERSON 2 (1999) 110-121
Karaszová, Katarína (2004),
Bedeutsame Augenblicke in der Personzentrierten
Therapie – Reflexionen einer Therapeutin, in: PERSON 1 (2004) 13-20
Keil,
Sylvia (2003),
„Wenn
ich mich so wie ich bin akzeptiere, dann ändere
ich mich.“ Methodische Implikationen
Klientenzentrierter Psychotherapie,
in: PERSON 1 (2003)
37-50
Keil, Wolfgang W. (1997), Geschichtliche
Entwicklung und inhaltliche Ausrichtung der ÖGwG (Österreichische Gesellschaft
für wissenschaftliche, klientenzentrierte Psychotherapie und personorientierte
Gesprächsführung), in: PERSON 2 (1997) 111-116
Keil, Wolfgang W. (1997), Hermeneutische
Empathie in der Klientenzentrierten Psychotherapie, in: PERSON 1 (1997) 5–13
Keil, Wolfgang W. (1997), Zum gegenwärtigen
Stand der Klientenzentrierten Psychotherapie, in: PERSON 2 (1997) 128–137
Keil, Wolfgang W. (1998), Der
Stellenwert von Methoden und Techniken in der Klientenzentrierten Psychotherapie,
in: PERSON 1 (1998) 32-44
Keil, Wolfgang W. (2000), Rezension: Peter F. Schmid,
Personzentrierte Gruppenpsychotherapie. Ein Handbuch, Bd. I: Solidarität und
Autonomie, Köln (EHP) 1994, in: PERSON 2 (1999) 144f
Keil, Wolfgang W. (2000), Rezension: Sander, Klaus,
Personzentrierte Beratung. Ein Arbeitsbuch für Ausbildung und Praxis, in:
PERSON 2 (2000) 65
Keil,
Wolfgang
W. (2001),
Ausbildung in Klientenzentrierter Psychotherapie der ÖGWG in der Ukraine
1994-1999, in: PERSON 1 (2001) 65ff
Keil, Wolfgang W. (2001),
Das für Psychotherapie notwendige Erleben Oder:
Personzentrierter und experienzieller Ansatz
gehören zusammen, in: PERSON 2 (2001) 90-97
Keil, Wolfgang W. (2002),
Zur Erweiterung der
personzentrierten Therapietheorie, in: PERSON 1
(2002) 34-44
Keil, Wolfgang W. (2002), Rezension: Ryback,
D., Emotionale Intelligenz im Management. Wege zu
einer neuen Führungsqualität & Terjung B. / Kempf
T., Von der Klientenzentrierten Therapie zur
Personzentrierten Organisationsentwicklung (Person-Centered
Organization-Development – PCOD),
in: PERSON 2 (2002)
78f
Keil, Wolfgang W.
/ Gaul, Sylvia (2001), Editorial, in: PERSON 1
(2001) 3f
Kilborn, Mary (2000),
The Second PCA Colloquium, Kranichberg, Austria, 10-12 July 1999. A
Personal Impression, in: PERSON 1 (2000)
63-65
Kinigadner, Sonja (2004),
Klientenzentrierte Therapie-Ausbildung in Rumänien
– Ein Projekt der ÖGwG, in: PERSON 1 (2004) 69-73
Kirschenbaum, Howard (2002),
Carl Rogers’ Leben und Werk: Eine
Einschätzung zum 100. Jahrestag seines
Geburtstags, in: PERSON 1 (2002) 5–15
Klinglmair, Alfred im Gespräch mit Sauer,
Joachim (1999), Im Spannungsfeld zwischen Person und Organisation. Möglichkeiten
und Grenzen des Personzentrierten Ansatzes in der öffentlichen Verwaltung, in:
PERSON 1 (1999) 32-37
Ko
rbei,
Lore Korbei (1997), Editorial, in: PERSON 2
(1997) 95
Korbei, Lore (1997), "Was Peter über
Paul sagt ...". Supervision aus der Sicht einer Psychotherapeutin, in:
PERSON 2 (1997) 155–159
Korbei,
Lore
(1999), Rezension: Eugene T. Gendlin, Focusing –
orientierte Psychotherapie. Ein Handbuch der erlebensbezogenen Methode, München
(Pfeiffer) 1998, in: PERSON 2 (1999) 142f
Korbei,
Lore (1999),
Rezension: Eugene Gendlin / Johannes Wiltschko, Focusing in der Praxis.
Eine schulenübergreifende Methode für Psychotherapie und Alltag, München
(Pfeiffer) 1999, in: PERSON 1 (2000)
70f
Korbei,
Lore (1999), Vergabe
des 1. Internationalen Sigmund-Freud-Preises für Psychotherapie der Stadt Wien
an Prof. Dr. Sylvester Ntom Madu, in: PERSON 2 (1999) 155
Korunka, Christian (1997), Editorial, in:
PERSON 1 (1997) 3f
Korunka, Christian
(2003),
Humanismus und / oder Naturalismus – Eine
Auseinandersetzung zum Menschenbild und zum
Verständnis der Aktualisierungstendenz im PCA.
Einleitung,
in: PERSON 1 (2003)
81
Korunka, Christian /
Nemeskeri, Nora / Sauer, Joachim
(2001)
Carl
Rogers als Psychotherapieforscher. Eine kritische
Würdigung, in: PERSON 2 (2001) 68-89
Korunka,
Christian / Keil, Wolfgang W. / Haug-Eskevig,
Kristin (2003),
Klientenzentrierte Psychotherapie in Österreich.
Eine Bestandsaufnahme aus praxeologischer Sicht,
in: PERSON 1 (2003)
70-80
Korunka, Christian / Sauer, Joachim /
Steinhardt, Kornelia / Lueger-Schuster, Brigitte
(2000), Der Stellenwert des
Personzentrierten Ansatzes in der Supervision. Eine
empirische Bestandsaufnahme, in PERSON 2 (2000) 5-14
Korunka, Christian /
Stumm,
Gerhard
(2002),
Editorial,
in: PERSON 2 (2002)
3
Korunka, Christian / Zinschitz, Elisabeth
(1998),
Editorial, in:
PERSON 1 (1998) 3f
Kramer, Robert (2002), „Ich wurde von Rank’schem
Gedankengut angesteckt“.
Die Wiener Wurzeln des Personzentrierten Ansatzes,
in: PERSON 2 (2002)
5-18
Krebitz, Heimo (1999), Personale
Begegnung in der Körperlichkeit. Ein personzentrierter Ansatz in der Medizin,
in: PERSON 1 (1999) 21-24
Kriz, Jürgen (2001), Rogers’ Verhältnis zur
Wissenschaft, in: PERSON 2 (2001) 23-26
Kriz, Jürgen (2002),
Rezension: Keil, W.W /
Stumm, G. (Hg.): Die vielen Gesichter der
Personzentrierten Psychotherapie, in: PERSON 1
(2002) 95f
Kriz, Jürgen (2003), 50 Jahre empirische
Psychotherapieforschung. Rückblicke – Einblicke – Ausblicke, in: PERSON 2 (2003)
115-124
Kriz,
Jürgen (2003),
Mechanistischer Humanismus statt humanistischer
Systemtheorie? Eine Replik auf den Beitrag von
Jobst Finke,
in: PERSON 1 (2003)
82-84
Kühn-Mengel, Helga (2003), Der Personzentrierte
Ansatz in Deutschland. Entwicklungen und Herausforderungen aus der Sicht der
Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG e.V.), in:
PERSON 2 (2003) 172-174
Lietaer,
Germain (2004),
Nachruf
auf Jan Rombauts, in: PERSON 2 (2004) 173
Lottaz, Angelo (2002),
Das Unaussprechliche zu Wort
bringen. Gedanken zur Psychotherapie mit Opfern
der Folter in: PERSON 1 (2002) 77-87
Macke-Bruck,
Brigitte (2003), Die Erfahrungswelt in der
beruflichen Praxis. Theorie und Praxis aus der
Sicht einer Praktikerin, in: PERSON 1 (2003) 3-14
Mercier, Gérard (2004), Aktualisierungstendenz und Handlungsorganisation.
Zum Stellenwert der Konzeptualisierung im therapeutischen Prozess, in: PERSON 2
(2004) 91-101
Mitterhuber,
Beatrix (2000), Person als Schaltstelle von Veränderungsprozessen.
Eine Brille der mehrdimensionalen Betrachtung, in PERSON 2 (2000) 40-43
Murafi, Anette (2004), Personzentrierte Therapie bei einer depressiven
Klientin mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Eine Falldarstellung aus
einer psychiatrischen Klinik, in: PERSON 2 (2004) 137-146
Müller Doris / Thimm, Marion (2003), Von
der Persönlichkeitsentwicklung zur Faktenvermittlung? Was bleibt nach der neuen
staatlichen Ausbildungsordnung vom spezifisch Personzentrierten in der
Ausbildung zum Gesprächspsychotherapeuten?, in: PERSON 2 (2003) 144-150
Network
of the European Associations for Person-Centred Counselling and Psychotherapy
(NEAPCCP) (1999), Statutes, in: PERSON 2 (1999) 156-158
Neville,
Bernie (1997),
The
Person-Centred Ecopsychologist, in: PERSON 1 (1997) 75–81
Niebrzydowski,
Leon (1997), Self–disclosure
empathy and sexual dissatisfactions as the factors conditioning a successful
marriage, in: PERSON 1 (1997) 86–89
O'Hara, Maureen (1998), Personzentrierte
und experientielle Psychotherapie in einem kulturellen Übergangszeitalter, in:
PERSON 1 (1998) 5–14
O'Hara,
Maureen (2000),
Moments of eternity. What Carl Rogers has to offer brief therapists, in: PERSON
1 (2000) 5-17
O’Hara, Maureen / Wood,
John
K. (2001),
Das Bewusstsein von morgen kultivieren: Der
personzentrierte Prozess als transformierende
Schulung,
in: PERSON 2 (2001)
51-54
O'Leary, Charles (2004), Nachruf auf John Keith
Wood, in: PERSON 2 (2004) 174
Paciorek,
Tadeusz (2004), Die Bedeutung des
Personzentrierten Ansatzes für mich und meine Arbeit, in: PERSON 1 (2004) 51-54
Pelinka,
Brigitte
(2000),
Klientenzentrierte Kindertherapie.
Neue Aspekte vor dem Hintergrund der Persönlichkeitstheorie von Carl
Rogers,
in: PERSON 1 (2000) 43-51
Perino, Franco / Polestra, Elena (2004), Der Personzentrierte Ansatz in
der Medizin, in: PERSON 2 (2004)
125-136
Pernicka, Michal (2004),
Das Phänomen der Begegnung in der Psychotherapie,
in: PERSON 1 (2004) 31-42
Person-Centered
Association in Austria (PCA) (1999), Erklärung psychotherapeutischer
Vereine zur politischen Situation, in: PERSON 2 (1999) 154
Pörtner, Marlis (1997), Wider die
Beliebigkeit — spezifische Aspekte der Klientenzentrierten Psychotherapie, in:
PERSON 1 (1997) 66–71
Prouty,
Garry (2001),
Carl Rogers und die experienziellen Therapieformen: eine Dissonanz?, in: PERSON
1 (2001) 52ff
Ratzinger,
Hans-Peter / Zinschitz, Elisabeth
(2001),
Innenansichten – Außenansichten. Carl Rogers im
Licht biografischer Texte, in: PERSON 2 (2001)
9-19
Reisel, Barbara (2001),
The clinical treatment of the problem child.
Carl Rogers als Kinderpsychotherapeut, in: PERSON
2 (2001) 55-67
Rickenbacher-Fromer, Corinne (2003),
Die
Ingredienzen des therapeutischen Prozesses,
in: PERSON 1 (2003)
66-69
Rogers, Natalie (2001),
Carls
Rogers’ Theorie der Kreativität ins Leben
umsetzen, in: PERSON 2 (2001) 21f
Rudle, Ditta (1999), Der
Personzentrierte Ansatz in der journalistischen Arbeit, in: PERSON 1 (1999)
64-68
Sanders, Pete (2004), Nachruf
auf Tony Merry, in: PERSON 2 (2004) 173-174
Schmid, Peter F. (1997), "Einem
Menschen begegnen heißt. von einem Rätsel wachgehalten werden." (E. Lévinas).
Perspektiven zur Weiterentwicklung des Personzentrierten Ansatzes, in: PERSON 1
(1997) 14–14
Schmid,
Peter F. (1997), "to further cooperation on an international level in
the field of psychotherapy and counseling ...". Zur Gründung der World
Association for Person-Centered Counseling and Psychotherapy (WAPCCP). An
Association for the Science and Practice of Client–Centered and Experiential
Pychotherapies and Counselling, in: PERSON 2 (1997) 168–171
Schmid, Peter F. (1997), Die
"Arbeitsgemeinschaft Personenzentrierte Psychotherapie, Gesprächsführung
und Supervision (APG) – Vereinigung für Beratung Therapie und
Gruppenarbeit". Geschichte, Entwicklungen, Zielsetzungen, in: PERSON 2
(1997) 97–110
Schmid, Peter F. (1997), Förderung von
Kompetenz durch Förderung von Kongruenz. Inhaltliche und berufspolitische
Aspekte Personzentrierter Supervision, in: PERSON 2 (1997) 144–154
Schmid, Peter F. (1998),
State
of the Art personzentrierten Handelns als Vermächtnis und Herausforderung, in:
PERSON 1 (1998) 15–23
Schmid,
Peter F. (1999),
»to further
cooperation between person-centred institutions in Europe in the field of
psychotherapy and counseling ...«. Zur Gründung des Network of the European
Associations for Person-Centred Counselling and Psychotherapy (NEAPCCP), in:
PERSON 1 (1999) 87-89
Schmid,
Peter F. (1999), Person-Centered Essentials — Wesentliches und
Unterscheidendes. Zur Identität personzentrierter Ansätze in der
Psychotherapie, in: PERSON 2 (1999) 139-141
Schmid,
Peter F. (2000), Begegnung und Reflexion. Personzentrierte
Supervision als Förderung der Person im Spannungsfeld von Persönlichkeitsentwicklung
und Organisation,
in: PERSON 2 (2000) 15-27
Schmid, Peter F. (2000), Personale
Theologie – personale Seelsorge. Zum Diskurs zwischen Theologie bzw. Seelsorge
und dem Personzentrierten Ansatz, in: PERSON 1 (1999) 81-84
Schmid, Peter
F. (2000), World
Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling.
Das Selbstverständnis. Die neuen Statuten, in: PERSON 2 (2000) 62-64
Schmid, Peter F. (2001),
Herausforderungen. Neun Vignetten zum Stand eines
Syntagmenwechsels, in: PERSON 2 (2001) 103-108
Schmid, Peter F. (2002),
Die Person im Zentrum der Therapie. Zu den
Identitätskriterien Personzentrierter Therapie und
zur bleibenden Herausforderung von Carl Rogers an
die Psychotherapie, in: PERSON 1 (2002) 16-34
Schmid, Peter F. (2003), AEIOU - Doug Land und Österreich, in: PERSON 2
(2003) 176-177
Schmid, Peter F. (2005), Kreatives Nicht-Wissen. Zu Diagnose,
störungsspezifischem Vorgehen und zum gesellschaftpolitischen Anspruch des
Personzentrierten Ansatzes,
in: PERSON 1 (2005)
4-20
Schmid, Peter
F. / Spielhofer, Hermann (2000),
Editorial, in: PERSON 2 (2000) 3f
Schmid, Peter
F. / Spielhofer, Hermann (2005),
Personzentriert und störungsspezifisch?
Editorial, in: PERSON 1 (2005) 2f
Schmoeckel, Anette (2003),
„Unter falscher Flagge segeln“? Zur Situation der Gesprächspsychotherapie in
Deutschland im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung, in: PERSON 2 (2003)
135-143
Schneider, Ilse (1997), Begegnung mit
Natalie Rogers. Personzentrierte Ausdruckstherapie (12.-14. Sept. 97), Weggis,
Schweiz, in: PERSON 2 (1997) 138–143
Schneider, Ilse (1999), Die
Bedeutung des Personzentrierten Ansatzes für die Organisationspsychologie, in:
PERSON 1 (1999) 56-63
Schrödter,
Wolfgang (2000), Wer oder was bringt soziale Gebilde in Bewegung? Überlegungen
zu Konservativismus, Wandel und Entwicklung in sozialen Gefügen,
in: PERSON 2 (2000) 49-55
Schwab, Reinhold / Eckert, Jochen / Höger, Diether (2003), Zur Situation
der Gesprächspsychotherapie (GPT) in Forschung und Lehre in Deutschland, in:
PERSON 2 (2003) 101-114
Schwanzar,
Helmut (2000), Empathie als Erkennungsinstrument und Veränderungskonzept,
in: PERSON 2 (2000) 44-48
Schwanzar Helmut (2000), Jubiläumssymposium
2000 in Salzburg.
30 Jare GwG - 25 Jahre ÖGwG - 20 Jahre SGGT - 20 Jahre APG, in PERSON 1 (2000)
67f
Schweers,
Geerd (2000), Personzentrierter Ansatz und Supervision,
in: PERSON 2 (2000) 56-61
Schweinschwaller, Thomas / Rainer, Barbara (1999),
Theaterpädagogik als Förderung von Probehandeln. Der Personzentrierte
Ansatz in der Theaterpädagogik, in: PERSON 1 (1999) 16-20
Slunecko, Thomas (1998), Diesseits
und jenseits von Begegnung. Zur Integration psychotherapeutischer Schulen aus
personzentrierter Sicht, in: PERSON 1 (1998) 24–31
Snijders,
Hans (1999), Rezension: Peter F. Schmid,
Personzentrierte Gruppenpsychotherapie in der Praxis - Ein Handbuch. Bd. II: Die
Kunst der Begegnung, Paderborn (Junfermann) 1996, in: PERSON 2 (1999) 146-149
Speierer, Gerd–Walter (1997), Personzentrierte
Krisenintervention, in: PERSON 1 (1997) 62–65
Speierer, Gert-Walter (2002),
Qualitätskontrolle und
Prozessevaluation in der personzentrierten
Selbsterfahrungsgruppe. Empirische Ergebnisse, in:
PERSON 1 (2002) 65-76
Speierer, Gert-Walter (2003), Personzentrierte Ansätze in der
Medizinischen Psychologie, in: PERSON 2 (2003) 164-167
Spielhofer,
Hermann (1999), Empathie, hermeneutisches Verstehen
oder Konstruktion? Das Erkenntnisverfahren in der Klientenzentrierten
Psychotherapie, in: PERSON 2 (1999) 122-130
Spielhofer,
Hermann (2001),
Organismisches
Erleben und Selbst-Erfahrung. Ein Beitrag zur Diskussion der anthropologischen und persönlichkeitstheoretischen
Grundlagen im Personzentrierten Ansatz, in PERSON 1 (2001) 5ff
Spielhofer, Hermann (2002), Rezension:
Iseli, C. / Keil, W. W. / Korbei, L. / Nemeskeri,
N. / Rasch-Owald, S. / Schmid, P. F. / Wacker, P.
G. (Hg.), Person-/Klientenzentrierte
Psychotherapie und Beratung an der
Jahrhundertwende,
in: PERSON 2 (2002)
73-77
Spielhofer, Hermann
(2004), Psychotherapie als Prozess der Anerkennung, in: PERSON 2 (2004) 102-113
Hermann Spielhofer (2005),
Selbststrukturen bei narzisstischen Störungen und Borderline-Persönlichkeiten,
in: PERSON 1 (2005) 65-81
Stapert, Marta mit Unterstützung von Ynse
Stapert, Eszter Kováts und Ioana Serban (2004),
Focusing mit Kindern und in der Supervision in
Ungarn und Rumänien, in: PERSON 1 (2004)
78-79
Stipsits, Reinhold (2003), Doug Land (1929-2003), in: PERSON 2 (2003)
175-176
Stölzl, Norbert / Pokhmelkina, Galina /
Benko, Edwin (2004), Ausbildung in
Klientenzentrierter Psychotherapie der ÖGwG in Moskau 2000-2005, in: PERSON 1
(2004) 74-77
Stumm, Gerhard (1999), Klienten-/Personzentrierte
Psychotherapie in Österreich, in: PERSON 1 (1999) 5-10
Stumm, Gerhard (1999), Rezension: Jobst
Finke, Beziehung und Intervention. Interaktionsmuster, Behandlungskonzepte
und Gesprächstechnik in der Psychotherapie, Stuttgart
(Thieme) 1999, in: PERSON 2 (1999) 152f
Stumm, Gerhard (2001), Carl Ransom
Rogers, in: PERSON 2 (2001) 7f
Stumm, Gerhard (2001),
Der Personzentrierte Ansatz und die Selbstpsychologie, in: PERSON 1 (2001) 19ff
Stumm, Gerhard (2005), Rezension: Jobst
Finke, Gesprächspsychotherapie. Grundlagen und spezifische Anwendungen. 3.
neubearbeitete und erweiterte Auflage, in: PERSON 1 (2005) 83f
Stumm, Gerhard
/ Korunka, Christian / Zinschitz, Elisabeth
(2002), Editorial: in PERSON 1 (2002) 3f
Stumm, Gerhard
/ Sauer, Jochen (2001), Editorial: in PERSON 2
(2001) 3f
Süfke, Björn (2000), Rezension:
Wolfgang
Neumann, Spurensuche als psychologische Erinnerungsarbeit, in: PERSON 1 (2000) 69f
Swildens, Hans (2001),
Carl Rogers – Übernahme der Erbschaft, ohne
Idealisierung, in: PERSON 2 (2001) 32f
Timul'ák,
Ladislav (2004), Einige Ergebnisse der
Forschung über Significant Events in der Psychotherapie, in: PERSON 1 (2004)
5-12
Teml, Hubert
(1999), Der
Personzentrierte Ansatz in Schule und Lehrerbildung, in: PERSON 1 (1999) 47-55
Teusch,
Ludwig (2002),
Personzentrierte Angstforschung. Störungsbezogenes
Vorgehen und Ergebnisse, in: PERSON 2 (2002) 55-59
Teusch, Ludwig / Finke, Jobst (2003), Gesprächspsychotherapie-Forschung
in der Psychiatrie in Deutschland, in: PERSON 2 (2003) 158-163
Thorne, Brian (2000), Spirituelle
Verantwortung in einem säkularen Beruf,
in: PERSON 1 (2000) 23-31
Timul'ák, Ladislav (2004),
Personzentrierte und Experienzielle Psychotherapie
in der Slowakei,
in: PERSON 1 (2004) 63-65
Van
Kalmthout, Martin
(2000),
Towards an integrated person-oriented psychotherapy,
in: PERSON 1 (2000)
18-22
Volgger, Barbara / Laireiter Anton-Rupert / Sauer, Joachim
(2004), Burnout bei PsychotherapeutInnen.
Eine Studie bei Klientenzentrierten PsychotherapeutInnen in Österreich, in
PERSON 2 (2004)
114-124
Vymětal, Jan (2004),
Geschichte, gegenwärtige Situation und Zukunft des
Personzentrierten Ansatzes in Tschechien, in: PERSON 1 (2004) 43-50
Wakolbinger, Christine (2000),
Der Therapieprozess in der Personzentrierten Kindertherapie,
in: PERSON 1 (2000)
52-62
Waldl, Robert (2004),
Personzentriertes Coaching, in: PERSON 2 (2004) 164-171
Warner, Margaret S. (2002),
Psychologischer Kontakt,
bedeutungstragende Prozesse und die Natur des
Menschen. Eine Neuformulierung personzentrierter
Theorie, in: PERSON 1 (2002) 45-59
World
Association for Person-Centered Counseling and Psychotherapy (WAPCCP). An
Association for the Science and Practice of Client–Centered and EXperiential
Pychotherapies and Counselling (1997), Provisional
Statutes, in: PERSON 2 (1997) 172f
Zinschitz, Elisabeth (1997), Der
Personzentrierte Ansatz in der Behindertenarbeit, in: PERSON 2 (1997) 120–127
Zinschitz,
Elisabeth (2001),
Prä-Therapie – Eine Antwort auf eine lange nicht beantwortete Frage. Die Klientenzentrierte Psychotherapie in der Arbeit mit psychisch kranken oder
geistig behinderten Menschen, in: PERSON 1 (2001) 44ff
Zinschitz,
Elisabeth (2002),
Beziehung: Ein
tausendfach reflektierender Spiegelsaal.
Kontakt und Wahrnehmung als beziehungsgestaltende
Elemente, in: PERSON
2
(2002)
45-54
Zurhorst, Günter
(2003),
Personzentrierter Ansatz und Neuro-Phänomenologie.
Eine kurze Replik auf den Beitrag von Jobst Finke,
in: PERSON 1 (2003)
85-87


Internationale Zeitschrift für Personzentrierte
und Experienzielle Psychotherapie und Beratung
gegründet
1997
bis 2001: PERSON. Zeitschrift für Klientenzentrierte Psychotherapie
und Beratung
(neue & aktuelle Website in
Vorbereitung)
HERAUSGEBER/INNEN, REDAKTION,
RICHTLINIEN
VON VERLAG UND REDAKTION
Herausgeber
und Herausgeberinnen
ÄGG — Ärztliche
Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie, Ev.
Krankenhaus, PD. Dr. L. Teusch, D-44577
Castrop-Rauxel, Grutholzallee 21, Tel.: +49
2305 2858, Fax: +49 2305 2860, l.teusch@evk-castrop-rauxel.de
Forum —
Forum Personenzentrierte Praxis, Ausbildung und
Forschung,
A-1060 Wien, Otto-Bauer-Gasse 5/14, Tel./Fax: +43
1 402 53 40,
apg-forum@chello.at
DGPP
– Deutsche Psychologische Gesellschaft für
Gesprächspsychotherapie,
c/o Psychologisches Institut III der Universität
Hamburg, Van-Melle-Park 5, D-20146 Hamburg, Tel.:
+49 40 42838-5362, Fax: +49 40 42838-6170,
jeckert@unihamburg.de
IPS — Institut für
Personzentrierte Studien, A-1030 Wien,
Dißlergasse 5/4, Tel.: +43 1 713 77 96, Fax: +43
1 7187832, office@ips-online.at
ÖGwG — Österreichische Gesellschaft für
wissenschaftliche klientenzentrierte
Psychotherapie und personorientierte
Gesprächsführung, A-4020 Linz, Altstadt 17, Tel.
/ Fax +43 732 784630, oegwg@psychotherapie.at
SGGT —
Schweizerische Gesellschaft für
Personzentrierte Psychotherapie
und Beratung, CH-1005 Zürich,
Josefstr. 79, Tel.: +41 1 2717170, Fax: +41 1
2727271, sggtspcp@access.ch
VRP — Vereinigung
Rogerianische Psychotherapie, A-1091 Wien, Postfach 33,
office@vrp.at
Verleger
und Druck
WUV — Universitätsverlag, A-1090 Wien, Berggasse 5, Tel.: +43 1 310 53 56, Fax:
+43 1 3197050, verlag@wuv.co.at, Homepage
www.wuv.co.at
Satz und Layout
Gerhard Krill, A-1070 Wien, Kaiserstr. 14/7,
grafik@krill.at
Redaktion
Christiane Bahr, Michael Behr, Franz Berger, Ulrike Diethardt, Jobst Finke, Mark
Galliker, Diether Höger, Dagmar Hölldampf, Robert Hutterer, Wolfgang W. Keil,
Christian Korunka, Gerhard Lukits, Peter F. Schmid, Hermann Spielhofer, Tobias
Steiger, Gerhard Stumm, Monika Tuczai
Fachbeirat
Béatrice Amstutz, Clara
Arbter-Rosenmayr, Anna Auckenthaler, Niklas
Baer,
Christiane Bahr, Elfriede Bartosch, Robert Bauer,
Ludwig Becker, Michael Behr, Edwin Benko, Eva-Maria Biermann-Ratjen, Johannes
Binder, Ute Binder, Ilona Bodnar, Claudia
Boeck-Singelmann, Rosina Brossi, Rainer Bürki, Olaf de
Haas,
Miriam de Vries, Martina Dienstl, Gottfried Dohr,
Ulrike Dollack, Harald Doppelhofer,
Sybille Ebert-Wittich, Jochen Eckert, Karin
Eisner-Aschauer,
Reinhold Fartacek, Margarete
Fehlinger, Christian Fehringer,
Andrea Felnemeti,
Irmgard Fennes, Peter Figge,
Peter Frenzel, Renata Fuchs,
Sylvia Gaul, Christine Geiser-Juchli,
Susanne Gerckens, Walter Graf,
Simone Grawe, Charlotte Gröflin-Buitink, Hiltrud
Gruber, Regula Haefeli, Klaus Heinerth, Ernst Hemmert,
Hans Henning, Ruth Hobi,
Beate Hofmeister, Anita Hufnagl, Catherine
Iseli Bolle, Dora Iseli Schudel,
Dietlinde Kanolzer, Sylvia Keil, Sonja
Kinigadner, Lore Korbei, Ruth Koza, Franz Kraßnitzer, Jürgen Kriz,
Dorothea Kunze,
Barbara Kurzmann,
Elke Lambers, Margarethe Letzel,
Germain Lietaer, Hans-Jürgen Luderer, Brigitte Macke-Bruck, Ueli Mäder, Jörg
Merz,
Beatrix Mitterhuber, Dietrich Moshagen,
Doris Müller, Annette Murafi, Khalid
Murafi,
Gerd Naderer,
Sibylle Neidhart, Nora Nemeskeri,
David Oberreiter, Alfred Papst, Brigitte Pelinka,
Josef Pennauer, Henriette Petersen, Marlis Pörtner, Barbara Reisel,
Klaus Renn, Brigitte Rittmannsberger,
Eckart Ruschmann, Bruno Rutishauser,
Klaus Sander, Eva-Maria Schindler,
Sabine Schlippe-Weinberger, Stefan
Schmidtchen, Christoph Schmitz, Wolfgang Schulz, Reinhold Schwab,
Helmuth Schwanzar, Klaus-Peter
Seidler,
Karl F. Sommer, Gert-Walter Speierer,
Dora Stepanek,
Norbert Stölzl, Ursula Straumann,
Hans Swildens, Beatrix Teichmann-Wirth, Beatrix Terjung,
Ludwig Teusch, Brian Thorne,
Ottilia Trimmel, Richard van
Balen, Martin van Kalmthout, Angelika Vogel-Hilburg,
Helga Vogl, Madeleine Walder-Binder,
Kurt Wiesendanger, Agnes Wild-Missong, Johannes Wiltschko, Marietta
Winkler, Andreas Wittrahm,
Hans Wolschlager, Heidrun Ziegler,
Elisabeth Zinschitz.
Richtlinien
Veröffentlicht werden wissenschaftliche Beiträge, Praxisberichte, Projektberichte,
Tagungsberichte, aktuelle Stellungnahmen, Diskussionsforen und Rezensionen aus dem Gebiet
der Person-/Klientenzentrierten Psychotherapie, aus anderen Bereichen des
Personzentrierten Ansatzes und in besonders begründeten Fällen aus angrenzenden
Gebieten. In der Regel werden Originalbeiträge publiziert, des
Weiteren Beiträge, die
die wesentlichen Aussagen einer umfangreicheren Publikation zusammenfassend darstellen,
oder Beiträge, die in der vorgelegten Form ansonsten schwer zugänglich wären,
beispielsweise Übersetzungen aus anderen Sprachen.
Über die Veröffentlichung entscheidet die Redaktion, die dazu Gutachten einholt.
Ein Fachbeirat unterstützt die Redaktion in konzeptioneller und fachlicher
Hinsicht.
Es
wird auf sprachliche Gleichbehandlung Wert gelegt.
Wenn es nicht ausdrücklich erwähnt ist, sind bei
geschlechtsspezifischen Formulierungen beide
Geschlechter in gleicher
Weise gemeint.
Erscheinungs
hinweise
2 Nummern pro Jahrgang.

Hinweise
zur Manuskriptabgabe
D
ie Beiträge sind
gemäß Merkblatt "Hinweise für Autorinnen und
Autoren" gestaltet auf Diskette oder als E-Mail-Attachment (nach Möglichkeit Format
*.rtf)
an eine der Redaktionsadressen abzuliefern:
PERSON.
Internationale
Zeitschrift für Personzentrierte und
Experienzielle Psychotherapie und Beratung,
• c/o Dr.
Franz Berger, CH-4001, Basel, Münzgasse 16; Tel.: +41 61 2672929; Fax: +41 61
2672934, franz.berger@bs.ch
• oder:
c/o
Prof. Dr.
Diether Höger,
D-33613 Bielefeld, Barlachstr. 36; Tel.:
+49 521 885548; Fax: +49 521 889924,
diether.hoeger@uni-bielefeld.de
• oder c/o Mag.Wolfgang
W. Keil, A-1080 Wien, Albertgasse 39; Tel.:+43 1
4075587; Fax:+43 1 40755874, wolfgang.keil@aon.at
• oder c/o a. Univ.Prof. Dr. Christian Korunka, Institut f. Psychologie der Univ. Wien, A-1010 Wien,
Liebiggasse 5, Tel.: +43 1 427747827; Fax: +43 1 4066422, christian.korunka@univie.ac.at
Zusendungen sollen enthalten
-
Autor bzw. Autorin, Titel, allenfalls Untertitel
-
Zusammenfassung (Abstract), deutsch und englisch, max. je 120 Wörter
-
Stichwörter (Keywords), ca. 3-5
-
Text, allenfalls inkl. Fußnoten, Tabellen, Grafik etc.
-
Literaturverzeichnis: gemäß
Merkblatt "Hinweise für Autorinnen und Autoren"
-
Biografie:
Angaben zum Autor bzw. zur Autorin (3–5 Zeilen: Geburtsjahr, Beruf,
psychotherapeutische/beratende usw. Tätigkeit und allenfalls Ausbildungstätigkeit,
wichtige Publikationen, Arbeitsschwerpunkte)
-
Kontaktadresse und E-Mail-Adresse
Zitationsweise
Die Zitationsweise erfolgt nach den Regeln
der American Psychological Association (APA) bzw. analog nach den Regeln der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs).
Die Titel von Carl Rogers sind nach der Rogers–Bibliographie von Peter F. Schmid
(www.pfs-online.at/rogers.htm)
zitiert. Die Jahreszahl mit dem Kleinbuchstaben bezeichnet das
Ersterscheinungsjahr, die Seitenzahlen in deutschsprachigen Texten beziehen sich
auf die angegebene deutschsprachige Ausgabe.
Zu Details siehe das Merkblatt für AutorInnen (pdf).
Urheberrecht
Autorinnen und Autoren, die einen
Beitrag zur Veröffentlichung einreichen,
garantieren damit, dass es sich (wenn nicht
ausdrücklich anderes vereinbart wurde) um einen
Originalbeitrag handelt und kein Copyright oder
andere Rechte verletzt werden, dass sie somit das
alleinige Verfügungsrecht besitzen, und weder
diesen Beitrag noch einen, der diesem in seinem
Inhalt im Wesentlichen entspricht, andernorts zur
Publikation einreichen. Sie garantieren der
Zeitschrift PERSON (wenn nicht ausdrücklich
anderes vereinbart wurde) das nicht-exklusive,
unwiderrufliche und kostenlose Recht zur gesamten
oder teilweisen Veröffentlichung ihres Beitrages
auf deutsch sowie in der eingereichten Sprache,
falls diese eine andere als deutsch ist. Es steht
den Autorinnen und Autoren frei, den Beitrag nach
Ablauf eines Jahres ab dem Zeitpunkt des
Erscheinens unter Angabe der Zeitschrift PERSON
als Ort der Erstveröffentlichung andernorts zu
publizieren.
Die
PERSON im Internet: www.personzentriert.at
ISSN 1028-683

BESTELLUNG
Bestellungen sind über jede
Fachbuchhandlung oder direkt beim Verlag möglich.
Bezugspreis jährlich (2 Nummern) € 16 zzgl. Versandkosten. Einzelpreis € 9,50 zzgl. Versandkosten. Mitglieder von
ÄGG,
DPGG, Forum, IPS, ÖGwG, SGGT
und VRP
erhalten PERSON im Rahmen ihrer
Mitgliedschaft; GwG-Mitglieder können PERSON über die GwG zu einem Vorzugspreis
bestellen. Das Abonnement verlängert sich automatisch, wenn nicht sechs Wochen vor
Jahresende schriftlich gekündigt wurde.
WUV Universitätsverlag
A-1090 Wien, Berggasse 5,
Tel.: +43 1 3105356, Fax +43 1 3197050, E-Mail: verlag@wuv.co.at
oder in jeder Fachbuchhandlung
I was favourably
impressed by the lay-out, production and substance.
Godfrey T.
Barrett-Lennard, Australia, May 2002
© Peter F. Schmid pfs
1998-2006
 Personzentrierte
& experienzielle Zeitschriften
Personzentrierte
& experienzielle Zeitschriften
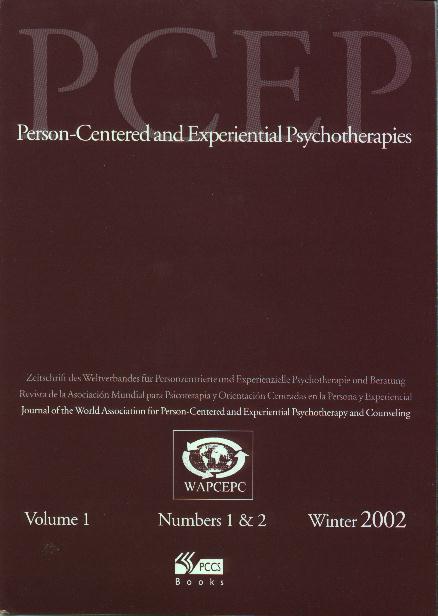 Person-Centered
and Experiential Psychotherapies. Zeitschrift des
Weltverbands
Person-Centered
and Experiential Psychotherapies. Zeitschrift des
Weltverbands
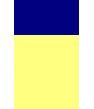 Zeitschrift
DIAKONIA
Zeitschrift
DIAKONIA
 Aktuelle personzentrierte Bücher
(seit 1990)
Aktuelle personzentrierte Bücher
(seit 1990)
 Bücher und Bibliografien
Peter F. Schmid
Bücher und Bibliografien
Peter F. Schmid
 Publikationsliste Peter F. Schmid
Publikationsliste Peter F. Schmid
 Aktuelle Papers von Peter F.
Schmid
Aktuelle Papers von Peter F.
Schmid
 Aktuelle Infos
Aktuelle Infos
 Hauptseite
Peter F. Schmid
Hauptseite
Peter F. Schmid

 English mainpage
English mainpage 
 Zum Seitenanfang
Zum Seitenanfang
